„Aua! Das tut weh!“
Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler über die Ehrlichkeit, Unrecht einzugestehen und beim Namen zu nennen

Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler findet: Erlebt man Unrecht durch andere Menschen, hilft ein offenes, ruhiges und klärendes Gespräch am meisten.
Irene kommt von der Arbeit nach Hause. Hier riecht es doch verbrannt? Sie stürzt in die Küche und reißt die Kürbissuppe vom Herd. Die Platte glüht wie Lava. Den Topf kann sie wegwerfen. Ihre Tochter sitzt vorm Fernseher. „Kannst du nicht aufpassen?“, faucht Irene. „Du hast fast die Wohnung abgefackelt!“ „Ich? Wieso?“, antwortet die Tochter in dem gelangweilt-gedehnten Ton, der Irene in Rage bringt.
Beim Empfang praktiziert einem ein 100-Kilo-Mann einen großzügigen Rotweinflecken aufs neue Kleid, trappt einem final auf die Zehen und kommentiert das seelenruhig mit „Hoppla“. Anschließend eilt er frohgemut weiter. Anderes Beispiel: Mitarbeitende fassen sich nach Jahren ein Herz und gehen zum Chef. Sie haben es satt, ständig cholerisch und unfair abgekanzelt zu werden. Aber alles bleibt, wie es ist. Er unternimmt nicht mal den Versuch, sich zu ändern. Oder: Wer Besuch in einer Justizvollzugsanstalt macht, trifft auf unglaublich viele Menschen, die „unschuldig“ einsitzen. Ich selber war bei einer Bibelarbeit fast sprachlos, als fast zwei Drittel der jungen Männer erklärten, bei ihnen habe sich der Richter wirklich geirrt – ausnahmsweise sie seien der Justiz zum Opfer gefallen.
Was fängt man mit Leuten an, die kein Unrechtsbewusstsein haben? Die auf Kritik oder einen Schuldvorwurf mit dem Ausdruck größter Verwunderung oder Empörung reagieren? Soll man das Töchterchen begütigend in den Arm nehmen, dem Koloss unter Schmerzen hinterherwinken und dem Chef aus Angst recht geben? Den Knackis verständnisvoll mit „verkorkster Jugend“ kommen und Eltern, die irgendwie versagt haben? Nein. Und noch mal nein. Menschen, die etwas vermasselt haben, und die, die davon betroffen sind, brauchen weder Gefühlsduselei noch Angst, sondern Klarheit.
Respekt vor sich selbst erfordert Ehrlichkeit, Unrecht einzugestehen
Wer quasi die Feuerwehr anrücken lässt, weil er auf sein Abendessen nicht aufpassen kann, wer einen arztreif tritt und unübersehbar bekleckert, wer Untergebene malträtiert, der soll merken können, was er angerichtet hat. Und das geht oft nur, wenn er die Chance bekommt, wirklich zu spüren, wie es dem Gegenüber geht. Gelegentlich kann es deshalb nützlich sein, mal kurz und heftig zu explodieren, um sich verständlich zu machen: „Aua! Das war mein Fuß! Das tut weh!“ Manchmal reicht der knappe Hinweis, was einen warum fuchst: „Das. Ist. Mein. Lieblingskleid!“
Am besten ist natürlich ein offenes, ruhiges und klärendes Gespräch: „So lassen wir nicht mit uns umspringen! Wir möchten, dass Sie unsere Beschwerden ernst nehmen.“ Oder: „Wenn ich den Herd nicht abgeschaltet hätte, wäre womöglich ein Zimmerbrand entstanden – und du wärst in höchster Gefahr gewesen!“ Oft kriegt jemand, der bislang gedanken- und rücksichtslos durch die Weltgeschichte trabte, erst auf diese Weise ein Gefühl für andere. Dadurch, dass man ihm konsequent und ehrlich Anteil gibt an den eigenen Gedanken, Gefühlen, Verletzungen.
Auch ein Mensch, der straffällig geworden ist und sich zu Unrecht ungerecht behandelt fühlt, braucht Konfrontation durch jemanden, der sich ehrlich für ihn interessiert. Der aufmerksam zuhört, aber unbequeme Wahrheiten ausspricht. Unrechtsbewusstsein kann man lernen – dann, wenn man fühlen und tatsächlich begreifen darf, was die eigenen Handlungen beim anderen auslösen. Schließlich: Wenn man merkt, dass Respekt vor sich selbst Ehrlichkeit erfordert. Die Ehrlichkeit, Unrecht einzugestehen. Und es beim Namen zu nennen.
Susanne Breit-Keßler
Der Text ist erschienen in chrismon und im Magazin „ZUTATEN. Themenheft zur Fastenaktion der evangelischen Kirche 2019“, edition chrismon.
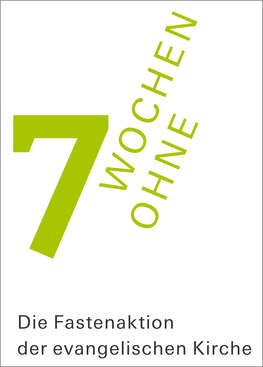
Die Fastenaktion der evangelischen Kirche



