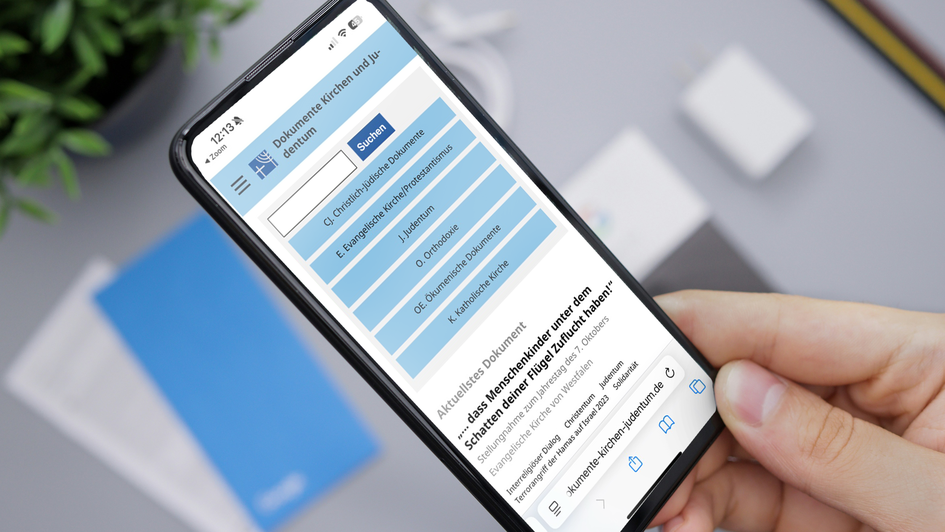Eigentlich sind alle Christenmenschen „Antisemitismusbeauftragte“
Interview mit Christian Staffa, erster Antisemitismusbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland

Christian Staffa ist der erste Antisemitismusbeauftragte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD).
Berlin (epd). Christian Staffa ist seit dem 18. Oktober erster Antisemitismusbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) erläutert er, warum die Kirche dieses Amt braucht und warum Judenhass unter Christen ein Problem ist.
Der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat Sie zum ersten Antisemitismusbeauftragten der evangelischen Kirche berufen. Warum braucht die Kirche dieses Amt?
Christian Staffa: Eigentlich sind alle Christenmenschen nach biblisch theologischer Botschaft „Antisemitismusbeauftragte“. Denn Antisemitismus ist Unglaube. Die kirchliche Tradition hat sich zu Unrecht antijüdisch positioniert, denn nicht nur war und bleibt Jesus Jude, sondern die ganzen Schriften sind nicht vom Judentum und unserer bedingungslosen Angewiesenheit auf das Judentum damals und heute zu trennen. „Antisemitismus widerspricht allem, wofür Christentum steht“, sagt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, zu Recht und weist auf das Versagen der Kirchen hin.
Statt Judenhass zu bekämpfen haben sie ihn oft genug bis hin zum Mörderischen gestärkt. Das Mörderische schien in Halle gerade wieder auf, aber nicht als kirchliches Momentum. Was den Antisemitismus, die Judenfeindschaft für Christen so attraktiv gemacht hat, ist aber weitestgehend unverstanden. So braucht die Kirche viele Christen, die sich dessen bewusst sind, und die Gesellschaft braucht eine Kirche, die auf die christliche Grundierung auch des säkularen Antisemitismus hinweist. Insofern brauchen Kirche und die sie umgebend und in ihr wohnende Gesellschaft Aufklärung und Herzensbildung, zu der ein Beauftragter beizutragen versuchen kann und soll.
Wo sehen Sie Handlungsbedarf?
Staffa: Als Evangelische Akademien in Deutschland haben wir gerade die Schrift „Antisemitismus und Protestantismus“ herausgegeben, in der wir den Spuren des christlichen Antisemitismus im Gestern und Heute nachgehen und Grundlagen für einen offensiven Umgang mit dem Thema zu schaffen versuchen. In der Berliner Landeskirche haben wir eine Broschüre produziert, in der wir anhand der gottesdienstlichen Liturgie jüdische Elemente aufzeigen und Möglichkeiten der Bewusstmachung dieser Verwobenheit mit der jüdischen Tradition und Gegenwart im gottesdienstlichen Handeln anbieten. Beides wird sehr gut aufgenommen. Das muss nun weiter betrieben und in die Ausbildung von Theologinnen, Religionspädagogen, Diakoninnen und Ehrenamtlichen integriert werden. Da ist universitäres und kirchenleitendes Handeln vonnöten, Bereitschaft in Gemeinden und auch Lust auf neue Entdeckungen, die durch diese Arbeit gemacht werden.
Gibt es auch in der Kirche einen Nährboden für Judenhass – einen spezifisch „christlichen“ Antisemitismus?
Staffa: Das einschlägige Zitat für mich ist von Theodor Wiesengrund Adorno aus den Antisemitismusthesen in der Dialektik der Aufklärung: „Im Bild des Juden, das die Völkischen vor der Welt aufrichten, drucken sie ihr eigenes Wesen aus. Ihr Gelüste ist ausschließlicher Besitz, Aneignung, Macht ohne Grenzen, um jeden Preis. Den Juden, mit dieser ihrer Schuld beladen, als Herrscher verhöhnt, schlagen sie ans Kreuz, endlos das Opfer wiederholend, an dessen Kraft sie nicht glauben können.“
Der Mechanismus der hier angedeutet wird, ist der: Die eigenen Glaubensdefizite einerseits und Abgründe andererseits werden auf „den Juden“ projiziert und an ihm bekämpft. Der eigene Unglaube findet so ein Ventil. Der Nährboden ist das christliche Selbstbild, das mit den eigenen Defiziten und Schuldgefühlen nicht umzugehen weiß. Darüber muss viel mehr gesprochen werden: Was macht uns Mühe im Glauben, was Lust, was projizieren wir auf „den anderen“, „den Juden“?
Interview: Corinna Buschow