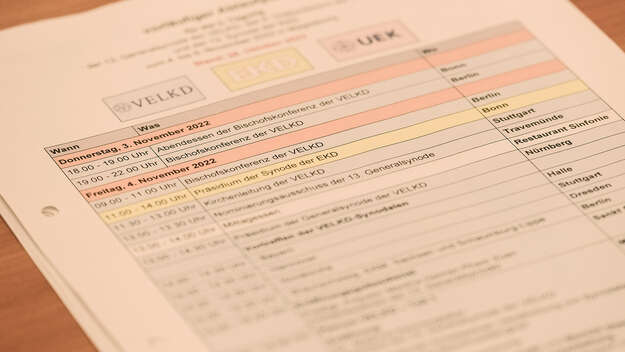Ratsbericht
3. Tagung der 13. Synode der EKD vom 6. bis 9. November 2022 in Magdeburg
Vorsitzende des Rates der EKD, Präses Annette Kurschus
Ihre Cookie-Einstellungen verbieten das Laden dieses Videos
Bericht des Rates der EKD (mündlich)
Ratsvorsitzende der EKD, Präses Annette Kurschus
Bericht des Rates (mündlich) zum Download
-
I. Und plötzlich wird man ganz gewiss
Es gilt das gesprochene Wort
Es gibt Erlebnisse, Hohe Synode, liebe Brüder und Schwestern, die machen plötzlich etwas klar. Und auf einmal wird man wieder ganz gewiss. „Gespräch mit dem Koordinationsrat der Muslime“ stand im Terminkalender, vor wenigen Tagen erst. Vertreterinnen und Vertreter der Evangelischen Kirche in Deutschland treffen Vertreterinnen und Vertreter des Koordinationsrates der Muslime. Wir sind nach Dortmund eingeladen, in die Räumlichkeiten der Abu Bakr Moschee. Überaus gastfreundlich werden wir empfangen und köstlich bewirtet. Zwischendurch, es ist Freitagnachmittag, unterbricht uns der Ruf des Muezzin zum Gebet. Schon in der gegenseitigen Vorstellungsrunde zu Beginn wird es dicht. Ganz kurze Schlaglichter nur auf persönliche und berufliche Wege, hier und da auf besondere Zäsuren und Weichenstellungen – und schnell ist klar: Hier sitzen nicht lediglich kirchliche und muslimische Funktionärinnen und Funktionäre zusammen am Tisch. Da reden Menschen miteinander, die ihren Glauben lieben und leben und ihm etwas zutrauen in der Welt. Und die ahnen: Wenn unser Glaube in dieser hoch angespannten und verunsicherten Welt seine Kraft entfalten soll – und wann hätte die Welt das nötiger von uns gebraucht als gegenwärtig? -, dann ist genau dieses Gespräch dran.
„Armut und Gerechtigkeit“ ist unser Thema. Ein Neutestamentler führt uns ein in den weiten Bedeutungsraum der beiden hebräischen Worte für Armut und Gerechtigkeit. Erstes Staunen: Wie nah die hebräischen und arabischen Worte einander sind! Und wie eng der Begriff „Gerechtigkeit“ in beiden Sprachen mit „Barmherzigkeit“ zusammenhängt. Ein muslimischer Kollege legt den Begriff „Armut“ aus Sicht des Sufismus aus. Sofort sind wir am Kern: Ist die Armut ein asketisches Ideal besonders frommer Menschen – und nicht vielmehr ein unerträglicher Skandal, wie die biblischen Propheten sagen? Eine Verletzung der menschlichen Würde? Etwas, das um Gottes und der Menschen willen nicht sein darf? Leidenschaftliche Debatten folgen, sehr schnell wird´s handfest und konkret. Ich stelle unsere Aktion #wärmewinter vor und lade ein mitzumachen. Bewegung kommt in den Raum. Eine muslimische Juristin erzählt mit leuchtenden Augen aus ihrer Gemeinde, was sie dort längst tun, um armen Menschen regelmäßige Mahlzeit anzubieten.
Es gibt Erlebnisse, die machen plötzlich etwas klar. Und auf einmal wird man wieder ganz gewiss.
-
II. Wozu es die Kirche braucht
Manche Frage, auf die ich schon so viele Antworten versucht habe, ist nach solchen Erlebnissen plötzlich gar keine Frage mehr.
Zum Beispiel die: „Wozu wird die Kirche gebraucht?“
Diese Frage wurde ich im ersten Jahr meines Ratsvorsitzes so häufig gefragt wie zuvor in meinem ganzen Leben nicht.
Manchmal klingt die Frage ehrlich interessiert, neugierig im besten Sinne des Wortes. Da wollen Menschen etwas erfahren, womöglich sogar lernen – oder sie suchen nach Vergewisserung.
Gelegentlich wollen mich welche intellektuell überführen: Stechend, bohrend, lauernd fragen sie. Mal sehen, ob sie eine Antwort weiß. Ob sie Argumente hat, die den klugen Gegenargumenten standhalten.
Oft hat die Frage einen müden Unterton, beinahe resigniert. Vor allem dann, wenn Menschen so fragen, denen die Kirche am Herzen liegt, die sich engagieren, die in ihr und für sie arbeiten, Tag und Nacht. In deren Frage schwingt mit: Sag´s uns bitte nochmal, bestätige uns in unserem Tun, wir brauchen das so nötig.
In letzter Zeit – seit bekannt wurde, dass der Anteil der Menschen, die in Deutschland einer der beiden großen christlichen Kirchen angehören, erstmalig unter die 50% gesunken ist – wird die Frage gern um ein ebenso kleines wie verräterisches Wörtchen erweitert:
„Wozu wird die Kirche noch gebraucht?“ So, als seien ihre Tage längst gezählt.
Je länger, je deutlicher wird mir klar: Die Frage stellt eine Falle. Sie verführt dazu, permanent um unsere eigene Relevanz zu kreiseln. Eine Kirche, die immer wieder erklärt, wozu sie da ist und gebraucht wird und wer und wie viele sie gut finden und warum, langweilt und verliert ihren Charme. Vor allem: Sie macht angestrengte, hektische, von Sorge um den eigenen Erhalt und von Angst vor dem eigenen Untergang getriebene Leute.
Nicht von Sorge und Angst getrieben, sondern von Gottes Verheißung beflügelt: So will der Rat der EKD, vor einem Jahr von der Synode gewählt, in seiner Amtszeit unterwegs sein – zusammen mit der Synode, der Kirchenkonferenz, unserer evangelischen Kirche. Mitten in der Welt, als Salz und Licht.
Ich mag das alte Wort „beflügelt“. Und vor einigen Tagen in der Moschee in Dortmund habe ich auf überraschende Weise erfahren, was es meint. Plötzlich war eine dynamische Kraft im Raum, die unmittelbar aus dem Geist der Texte der Heiligen Schriften kam. Im Hören auf die anderen, im eigenen Formulieren dessen, was mich selbst trägt und antreibt, habe ich gespürt: Wir sind auf die Spur Jesu gesetzt, mitten hinein in die dunklen Ecken und Stuben, geradewegs auf die konfliktbeladenen Schauplätze der Welt. Dazu müssen wir nicht Menschen mit Flügeln sein. (Rudolf Otto Wiemer)
-
III. „… fahrt hinaus…!“
„Auf dein Wort hin“ versuche ich´s noch mal, sagt einer, den die Erfahrung lehrt: Nach allem, was die Vernunft weiß und die Trends voraussagen, wird es vergeblich sein. „Aber weil du es sagst“, mach ich´s. Trotzdem. Obwohl viele laut oder leise denken: Es ist verrückt. Ist der naiv! Vermutlich hat er selber gedacht: Es wird nichts bringen. „Der Fischzug des Petrus“ ist die Geschichte in einigen Bibeln überschrieben. (Luther 2017) In anderen trägt sie die Überschrift „Die ersten Jünger“. (Basis Bibel).[1]
Jesus fordert den Fischer Simon, in dessen Boot er sitzt, auf: „Fahre hinaus, wo es tief ist!“ Der Rat sah sich durchaus in tiefe Gewässer geworfen, als er im November 2021 in Bremen endlich gewählt war. Nach mühsamer Wahlprozedur, digital vollzogen durch eine Synode, die sich selbst erst seit einigen Monaten konstituiert hatte und bis dahin noch nie – auch zur Ratswahl nicht – leibhaftig beieinander war. Ein Gremium, neu zusammengesetzt, mit einer prominenten Leitungsaufgabe betraut – und das in Zeiten, in denen sich Abgründe auftun und in der Kirche wie in der Politik das dominierende Gefühl herrscht: „Lange geht das nicht mehr gut.“ [2]
„Fahrt hinaus, wo es tief ist!“: So verstehen wir unseren Auftrag. Wir tragen Verantwortung für unsere Kirche und müssen uns dazu hinausbewegen aus vertrauten Denkmustern und bewährten Traditionen, hinein in ungesichertes Gelände, dahin, wo das Klima für die Kirche wie für die Gesellschaft rauer und die Gefahren bedrohlicher werden. Wir werden gebraucht als Institution, die – wie der Soziologe Hartmut Rosa in seinem kleinen Büchlein „Demokratie braucht Religion“ schreibt – „über Narrationen, über ein kognitives Reservoir verfügen, über Riten und Praktiken, über Räume, in denen ein hörendes Herz eingeübt und vielleicht auch erfahren werden kann.“[3] Rosa hält es gerade in diesen angespannten und hektischen Zeiten für das Wichtigste, dass wir aufhören – im doppelten Sinn dieses Wortes. Er schreibt: „Einerseits meint dieses großartige Wort ´aufhören´ anhalten, stoppen. Andererseits heißt das Wort auf-hören, dass ich (…) aufwärts höre, nach außen lausche, mich anrufen und erreichen lasse von etwas anderem, von einer anderen Stimme, die etwas anderes sagt als das, was auf meiner To-do-Liste steht und was sowieso erwartbar ist“.[4]
Darum geht´s: Uns erreichen lassen von einer anderen, von Gottes Stimme – und uns getrost ins Tiefe wagen. Dahin, wo nach menschlichem Ermessen kein Grund ist – und wo es für uns doch umso gewisser den Grund gibt, der gelegt ist, Christus.
[1] Lukas 5, 1-11
[2] Vgl. Hartmut Rosa, Demokratie braucht Religion, München 2022, 45.
[3] Hartmut Rosa, a.a.O., 55f
[4] Hartmut Rosa, a.a.O., 56
-
IV. „… wo es tief ist.“
#1Vier Orte will ich herausgreifen. Orte, wo es tief ist und nach menschlichem Ermessen kein Grund – und wo man leicht untergehen kann. Es sind die tiefen Krisen, die unsere Gegenwart schütteln.
- Der Krieg
Der See Genezareth, wo der Fischer Simon mit seinen Gefährten fischt, ist kein unschuldiges Gewässer; er steht für ein Kriegstrauma in der Zeit der Evangelien. Der See ist ein Kriegsschauplatz; an ihm hat sich eines der grausamsten Massaker im jüdischen Krieg zugetragen. Nach heutigem Recht wird die Tat als Kriegsverbrechen geächtet. Die römischen Truppen haben dort ein Blutbad angerichtet. „Mit Blut gefärbt und voll Leichen war der ganze See“[1] schließt der antike Geschichtsschreiber Flavius Josephus seinen ausführlichen Bericht darüber ab, wie dort Vespasians Soldaten ihre Mordlust befriedigt haben. Heute würde diese Bibelgeschichte in Butscha spielen.
Die Krise, die der Krieg in der Ukraine auslöst, ist so tief, dass sie alles, auch uns Kirchen in Deutschland, unweigerlich ansaugt und fordert. Wir können uns nicht zuschauend ans Seeufer stellen, das ist klar. Wir sind nicht Kriegspartei, aber wir sind parteilich für die unendlich leidenden Menschen in der Ukraine. Wir helfen den Geflüchteten, die zu uns kommen, froh, dass die Bundesregierung zumindest ihnen die Türen weit öffnet, und mit dem Wunsch, dass auch Geflüchtete aus anderen Regionen der Welt solche Erleichterungen bekommen.
Am Abend des 24. Februar, als die russische Armee die Ukraine überfallen hatte, waren unsere Kirchen offen, und Gläubige, Halbgläubige und Ungläubige haben sich in ihnen zu Friedensgebeten versammelt, Gott mit ihrem Bitten und Flehen um Frieden in den Ohren gelegen, ihren Protest und die Solidarität mit den Menschen in der Ukraine in Worte gebracht, gemeinsam die Sprachlosigkeit ausgehalten.
Doch auch das Andere gab es: Sehr schnell, zu schnell, waren Worte da, wo Schweigen, zumindest Zögerlichkeit, angebrachter gewesen wäre. Ein öffentlicher Streit brach los: Militärische Verteidigung, ja oder nein? Waffenlieferungen, ja oder nein? Pazifismus, ja oder nein? Trägt die kirchliche Friedensethik noch, ja oder nein? Diese unselige binäre Logik hielt Einzug auch in unsere Predigten und kirchlichen Stellungnahmen. Angesteckt durch den unmittelbaren Handlungsdruck, unter dem die Politiker und Politikerinnen standen, gab es auch in der Kirche kein Halten mehr – und kaum ein Innehalten, das gewagt hätte, das Fehlen eindeutiger Antworten auszuhalten. Meinungen und Urteile mussten her, und zwar sofort. Und es wurde deutlich, dass es neben der Nächstenliebe noch eine zweite Liebe gibt, nämlich die Liebe zur immer schon gehabten Lieblingsmeinung.
Unsere Stärke könnte, müsste sein, dass wir auch im Fragen nach Krieg und Frieden aufhören können – im doppelten Sinn: Aufhören mit den reflexhaften Reden, aufhorchen und aufeinander hören statt aufeinander einzureden. Im Gegensatz zu Politikerinnen und Politikern, die unmittelbar entscheiden müssen, haben wir die Freiheit – und, wie ich meine, auch die Pflicht! -, die Geschwindigkeit zu drosseln, wo die Ereignisse sich überstürzen, dem Nichtwissen das Wort zu reden, wo der Brustton der Überzeugung herrscht, mit dem Irrationalen zu rechnen, wo alles rational durcherklärt ist, Dilemmata zu formulieren, wo es vermeintlich nur richtig oder falsch gibt.
Ich wiederhole mich, weil es nicht oft genug gesagt werden kann: Waffen helfen, sich zu wehren und zu verteidigen, sie können Leben retten, und das ist sehr viel. Waffen allein schaffen aber keinen Frieden. Friede kann erst werden, wenn die Waffen schweigen und Gespräche möglich sind. Der Kriegstreiber Putin muss die Angriffe stoppen, ja, das wäre das einzig Gerechte. Aber er tut es nicht, allein weil wir es fordern. Darum habe ich am Reformationstag dafür geworben, das Gespräch nicht zu verachten und dem geistesgegenwärtigen Wort etwas zuzutrauen. Friedensverhandlungen mit Russland sind im Augenblick in weiter Ferne. Zur Solidarität mit der Ukraine und zu ihrer militärischen Unterstützung muss zwingend hinzukommen, in aller Mühsamkeit Wege zu einem Waffenstillstand zu suchen. Wer, wenn nicht wir Kirchen, hat die Freiheit zu fordern, was unmöglich scheint und doch so buchstäblich Not-wendig ist?
Der Ruf nach diplomatischen Bemühungen, um einen Waffenstillstand zu ermöglichen, ist weder herzlos noch ignorant gegenüber den Menschen in der Ukraine. Im Gegenteil. Er ist nüchtern realistisch und höchst aufmerksam für die Gefahr einer weiteren Eskalation des Krieges. Es geht mir nicht darum, die Ukraine zu Verhandlungen aufzufordern. Das wäre in der Tat naiv. Aber ich unterstreiche: Gespräche auf unterschiedlichsten Ebenen dürfen niemals für unmöglich erklärt werden. Und ich gehe davon aus, dass es Gespräche gibt.
Hier fassen wir uns kirchlicherseits an die eigene Nase: Wir erfahren in unseren Kontakten zur orthodoxen Kirche, wie schwer bis unmöglich es ist, mit dem Patriarchen Kyrill zu reden, dessen Legitimierung des Krieges als Gottes Werk ich für gottlos halte. Aber ich höre und bin dankbar dafür, dass die Gespräche auf anderen Ebenen sehr wohl weiter gehen. Oft im Verborgenen und in geschützten Räumen. Wir bleiben in Kontakt, helfen, unterstützen: diakonisch, seelsorglich und - wo möglich - auch vermittelnd. Das muss so bleiben! Hoffentlich, das gebe Gott, mit kleinen Erfolgen für den Frieden.
- Die Wasser
Der See mit seinen unberechenbaren Winden, seinen gefährlichen Stürmen, seinen Wassern, die sich zu Fluten aufbauen können – er erinnert an die Urflut am Anfang der Schöpfungsgeschichte. Der See ist eingehegtes Tohuwabohu, gebändigtes Chaos. Manchmal aber brechen die Fluten gefährlich und tödlich aus ihm hervor, niemals wieder jedoch so, dass die ganze Schöpfung in ihnen untergeht. Wie erstaunlich, wie wunderbar: Weil (und nicht obwohl!) der Mensch böse ist von Jugend auf: Darum, sagt Gott, will er die Welt nie mehr untergehen lassen. Gott selbst will alles tun, um die Erde, dieses Wunder, zu erhalten. In dieser Gewissheit und im festen Vertrauen auf Gottes Liebe zur Erde gehen wir ans Werk, einen Weltuntergang abzuwenden, den der Mensch heute selbst anzetteln kann.
Warum ich die Klimafrage für die gegenwärtig wichtigste Frage halte, hat mich kürzlich jemand kritisch gefragt. Meine Antwort ist so banal wie klar: Kriege, Hunger, Terror – all diese Geißeln der Menschheit können Millionen Menschenleben auslöschen. Die ungebremste Erderhitzung aber setzt die Bedingung der Möglichkeit menschlichen Lebens überhaupt aufs Spiel. Sie schränkt auch die Möglichkeiten ein, überhaupt noch Politik zu machen, denn Politik im Sinne von Demokratie braucht Entscheidungsspielräume. Wo aber die natürlichen Bedingungen immer mehr Sach- und Handlungszwänge schaffen, werden diese Spielräume immer enger.
Was in den biblischen Erzählungen von der Gewalt des Wassers archaisch anmuten könnte, erweist sich gegenwärtig als schaurige Wirklichkeit: Damals wie heute sind es die Gewalt unter Menschen und die Gewalt zwischen den Geschöpfen, die sich zu einem weltumspannenden Chaos auswachsen. Der Krieg in der Schöpfung wird zum Krieg mit der Schöpfung und gegen die Schöpfung, und die zeigt sich schließlich ihrerseits von ihrer lebensfeindlich gewalttätigen Seite.
Fragen nach Frieden und Sicherheit dürfen nicht ausgespielt oder aufgerechnet werden gegen Fragen des Klimaschutzes und der Bewahrung der Schöpfung. Klima- und Sicherheitspolitik, die ihren Namen verdient, wird nie zu Lasten, sondern stets zugunsten der Armen in aller Welt und auch zugunsten der Armen in unserem Land geschehen müssen. Darauf achten wir, und daran erinnern wir. Auch und zuerst uns selbst im Blick auf unsere Personal-, Mitglieder-, Gemeindeentwicklung und die Ausstattung unserer Gebäude, die uns so teuer sind – im doppelten Sinne dieses Wortes.
Es hat ein Gutes, dass alles mit allem zusammenhängt: Man muss nur an einer Stelle anfangen, und schon bewegt sich an vielen Stellen etwas. Dies allerdings muss man tun: anfangen. So beherzt wie Simon angefangen und sein Netz ausgeworfen hat, ohne Erfolgsgarantie. Anfangen müssen wir und fürs Anfangen werben, beharrlich, in der tiefen Gewissheit, dass der Weltuntergang keine gottgewollte Option ist.
- Die Armut
„Wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen.“ In Simons resigniertem Satz steckt eine Misere, mit der er nicht allein ist: Arbeiten, arbeiten, arbeiten – und dennoch fällt zu wenig zum Leben ab. So geht es seit Jahren – auch in unserm Land – vielen Menschen. Viel zu vielen. In den Armutsberichten kommen sie als Prozentzahl vor, und die ist schockierend, vor allem weil so viele Kinder arm oder armutsgefährdet sind.
Tief und tiefer wird die Krise jetzt, da die steigenden Energiekosten, die Inflation und demnächst die bereits angekündigte Rezession viele in den wirtschaftlichen Abgrund reißen könnte. Wenn wir nichts tun! Aber das werden wir, wir haben bereits damit angefangen. Ich habe eingangs von unserem leidenschaftlichen Austausch in der Dortmunder Moschee berichtet. Wir dürfen nie mit pausbackiger Abgefundenheit sagen: So ist die Welt. Einer wird an der Schlossallee geboren, der andere in der Badstraße. Eine erbt ein Vermögen, die andere Schulden. Kühlschrank leer, kalter Winter, Strom abgestellt, keine Pampers? Pech gehabt oder auch selbst schuld. Armut und Gerechtigkeit, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit: das sind die Kernthemen der Heiligen Schrift. Armut ist ein Mangel an Gerechtigkeit. Almosen sind gut, reichen aber nicht. Jeder Mensch hat ein Recht auf Hilfe, dem Schicksal der Armut zu entkommen.
Arme werden oft „sozial schwach“ genannt. Dabei sind arme Menschen sozial oft besonders stark! Ich halte es für eine riesige soziale Stärke, mit sehr wenig Geld dafür zu sorgen, dass die Kinder ihr Eis und ihren Burger bekommen und beim Kindergeburtstag der Freundin ein Geschenk mitbringen können. Es ist eine riesige soziale Stärke, jeden Cent umdrehen zu müssen und sein Leben so zu organisieren, dass man seine Würde behält. Das ist bei den allermeisten Menschen, die wenig Geld haben, der Fall – und ich bewundere sie dafür.
In diesem Winter sind wir Kirchen dringend gefragt, sozial stark zu sein. Die Aktion #Wärmewinter, das wünsche ich mir und dafür werbe ich, muss eine starke gemeinsame Aktion werden. Lassen Sie uns nicht kleinmütig sein. Wir werden unsere beiden Ziele übereinander bringen: Energie sparen und Wärme austeilen. Im kommenden Winter wird man nicht nur kritisch auf die Raumtemperatur blicken. Der öffentliche Blick wird sich auch darauf richten, ob Kirche und Diakonie entschlossen und gemeinsam etwas dafür tun, dass arme Menschen gut durch den Winter kommen. Viele Gemeinden und Einrichtungen sind längst hoch kreativ dabei.
- Demokratie
Von nun an sollst du Menschen fangen, sagt Jesus dem Simon. Diese Menschenfängerei ist mir lange nicht geheuer gewesen. Soll das etwa ein Bild für unseren kirchlichen Auftrag sein? Menschen fangen klingt eher nach einem Programm von Populisten. Das Evangelium meint bei genauer Betrachtung das genaue Gegenteil. Der Menschenfänger, der „zogron“, war in der antiken Welt derjenige, der die im Krieg erbeuteten Menschen den Soldaten, Piraten und Räubern auf dem Markt abkaufte. Simon Petrus soll – wie ein solcher „Zogron“ – Menschen den Dämonen abkaufen, Menschen von Mächten befreien, die sie versklaven und ihnen die Menschenwürde rauben. Dies allerdings ist eine Aufgabe, die unsere Kirche in der gegenwärtigen Krise der Demokratie dringend beschäftigen muss.
Ich sehe, wie der Streit über die Coronamaßnahmen, über das Impfen, über die Waffenlieferungen die Demokratie belastet, wie viele sich in Verschwörungsmythen flüchten, wie die Partei der Nichtwähler zur größten Partei wird, wie Populisten jedes Thema bespielen, das sich irgendwie nutzen lässt, um Menschen auseinanderzubringen. Mal durch Runterspielen, mal durch Aufbauschen, je nachdem, wie man es braucht, um Wut zu entfachen und Angst zu schüren. Und dies ist kein Phänomen irgendwo draußen in der Gesellschaft, sondern auch mitten in unserer Kirche. Die von der EKD geförderte interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur belegt das auf ernüchternde Weise.[2] „Die“ sind „wir“: Das ist die ungemütliche Erkenntnis. Unsere Kirchenmitglieder sind ein Spiegel der Gesellschaft. Es gibt bessere Nachrichten, aber auch schlechtere. Wäre es nicht schlechter, diese Menschen wanderten völlig in Parallelwelten aus? Ist es nicht ganz gut, dass sie bleiben? Ist es nicht ganz gut, dass sie noch erreichbar sind – über Gemeindebriefe, in Trauer-, Trau- und Taufgesprächen, im Heiligabendgottesdienst, bei der Konfirmation? Ich meine: Ja. Es hilft nichts, Ausgrenzung kategorisch mit Ausgrenzung zu beantworten. Das wäre kurzsichtig und würde dem Populismus in die Hände spielen. Es geht vor allem um diejenigen auf der Kippe, die oft nicht so wirken, aber zutiefst verunsichert sind - und doch noch erreichbar. Durch Menschenfischen eben.
Wir leben in keiner gespaltenen Gesellschaft, so gern die Rattenfänger dies auch behaupten. Wir leben in einer Gesellschaft, in der die allermeisten Menschen zusammenhalten, sich gegenseitig unterstützen, einsichtig sind, abgeben, kurz: mehr lieben als hassen. Wir Kirchen gehören, auch wenn die Mitgliederzahlen dramatisch sinken, zu den außerordentlich wichtigen Kräften, die Zusammenhalt stärken und praktizieren, und die fördern, was für eine Demokratie lebenswichtig ist: Vertrauen und Gerechtigkeit.
[1] Flavius Josephus, Der Jüdische Krieg, S. 294f
[2] Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung. Eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur
-
V. „Werft eure Netze zum Fang aus!“
Wer fischen will, braucht stabile Netze, zumal, wenn er hinaus ins Tiefe fährt und nicht in Ufernähe bleibt. „Kirchenentwicklung“ ist ein Schlüsselthema der neuen Ratsperiode. Wir arbeiten intensiv an unseren kirchlichen Netzen. Im Laufe der Zeit hat sich einiges an Ballast, mitunter auch Unrat, darin verfangen; Löcher sind entstanden. Das Netzwerk muss von Grund auf repariert werden, einige Netze anders geknüpft, manche sogar komplett ausgewechselt.
Das Netz ist längst zum Gegenbild einer hierarchisch funktionierenden und statisch organisierten Kirche geworden. Die einzelnen Knoten sind vielfältig verbunden, so dass die unterschiedlichsten Verbindungen möglich werden.
Ein Beispiel hierfür ist der Umbau der vertrauten und bewährten Kammerarbeit der EKD zu einem Netzwerk. Die 70 vom Rat berufenen Expertinnen und Experten werden – so die Grundidee – in flexiblen, wechselnden Konstellationen miteinander beraten. Im Netzwerk eben. Das ist ein Experiment, und ich freue mich, dass die Berufenen sich beinahe ausnahmslos wagemutig darauf einlassen.
Wir reden viel vom Loslassen, doch diesen einsichtigen Vorsatz unterlaufen wir in den komplexen Transformationsprozessen immer wieder. So viele Veränderungen gleichzeitig nebeneinander: Das auf Dauer gestellte Erproben und Experimentieren überfordert und verunsichert. Und verunsicherte Menschen sind nicht gut im Loslassen. Sie neigen dazu, sich an Vertrautes zu klammern.
Wir werden auch darüber nachdenken müssen, welche Konsequenzen sich für das Netz der kirchlichen Berufe und die entsprechenden Ausbildungsgänge ergeben. Schließlich bleibt davon auch das Miteinander von EKD und ihren zwanzig Gliedkirchen nicht unberührt. Wie wollen wir Aufgaben verteilen, wo können wir Synergieeffekte schaffen, wenn es um strukturelle, gesetzliche und organisationale Vereinheitlichung geht? Wir hatten hierzu in der letzten Tagung der Kirchenkonferenz eine intensive Debatte.
Im Verhältnis zwischen Kirche und Gesellschaft ist auf der lokalen Ebene viel Gemeinsames möglich: Es geht um Perspektiven einer sozialraumorientierten kirchlichen Arbeit, die nicht nur an ihren Rändern offener ist. Das fordert uns heraus, Gemeinschaft neu zu denken.
Die Frage der Digitalisierung – das Arbeiten und Organisieren und Kommunizieren im Netz – ist eine der großen Aufgaben für kirchliche Arbeit auf allen Ebenen. Und eine der riesigen Chancen! Zu Beginn der Coronapandemie haben wir staunend die vielfältigen Möglichkeiten digitaler Formate und Formen erlebt. In den letzten drei Jahren gab es diesbezüglich eine steile Lernkurve in allen kirchlichen Bereichen.
Digitale Kommunikation eröffnet vollkommen neue Wege, um die Reichweite kirchlicher Kommunikation zu steigern. Die nutzen wir zunehmend, doch da gibt es immer noch reichlich Luft nach oben. Darauf weist dankenswerter Weise unsere Präses der Synode unermüdlich hin. Digitale Kommunikation erweitert bestehende und ermöglicht eine Fülle neuer Gemeinschaftserfahrungen. Zugleich steht außer Frage, wie sehr wir daneben das leibhaftige Miteinander brauchen. Digitale und hybride Sitzungen vereinfachen vieles, zugleich hat die Kacheloptik ihre Grenzen – um nur ein Beispiel zu nennen. Beides gilt es im Blick zu behalten, beides gilt es in kluger Weise zu verbinden. Die jüngste Studie von midi, unserer Agentur für missionale und diakonische Innovation, zeigt: Gerade auch unsere hochverbundenen Mitglieder setzen inzwischen ganz selbstverständlich die digitale Interaktion mit Kirche voraus. Vieles läuft über den Faktor von authentischen Persönlichkeiten. Und da, wo wir persönlich Gesicht zeigen – so beweist die midi-Studie – bieten sich manchmal auch unverhoffte missionarische Chancen. Auch das gehört wesentlich zu unserem „Menschenfangen“ hinzu.
-
VI. „Sie winkten ihren Gefährten, die im andern Boot waren.“
„Wir sitzen doch in einem Boot“, betonen viele, wenn es um die konfessionelle Ökumene geht. Ja, wir sitzen in dem einen Boot der Kirche Jesu Christi. Das ist unsere große Stärke, die wir gerade in diesen krisengeschüttelten Zeiten fruchtbar machen können und müssen. Und ja, wir empfinden es - das wird unseren katholischen, freikirchlichen und orthodoxen Geschwistern nicht anders gehen als uns – in manchen Situationen auch als ärgerliche Schwäche, in einem Boot zu sein. Ist den einen der Wind zuwider, bläst er auch den anderen ins Gesicht. Kommen die einen ins Schlingern, schlingern die anderen mit. Da kann es schon mal dicke Luft an Bord oder auch Streit und Unversöhnlichkeit geben. In der biblischen Geschichte übrigens sind es mehrere Boote, die sich auf demselben Gewässer bewegen und dieselbe Aufgabe haben und nicht als Konkurrenten unterwegs sind, sondern einander beistehen!
Wie international und weltweit diese Gemeinschaft ist, haben viele von uns Anfang September bei der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe erlebt. Rein optisch war das eindrücklich: Kollarhemd, Soutane, Lutherrock, orthodoxe Kopfbedeckung - eine unglaubliche Vielfalt aus mehr als 350 Kirchen. Die Stadt und die badische Landeskirche zeigten sich als großartige Gastgeber. Im Herzen Europas und in der „Hauptstadt des Rechts“ hat dieser Ort symbolische Strahlkraft. Die Tage in Karlsruhe haben gezeigt: Die christlichen Kirchen sind auch über Divergenzen hinweg verbunden durch die gemeinsame Orientierung an Jesus Christus. Den großen globalen Krisen wie Klimawandel und Rassismus oder der eskalierenden privaten und öffentlichen können wir nur gemeinsam etwas Wirkungsvolles entgegensetzen.
Der Apostel Paulus erinnert uns, dass wir „Botschafter und Botschafterinnen der Versöhnung“ sind, geistliche Diplomatinnen und Diplomaten gewissermaßen. Zurzeit erleben wir weltweit und in unserer Gesellschaft täglich, wie enorm wichtig Diplomatinnen und Diplomaten sind: Unermüdlich betreiben sie das mühsame Geschäft, aus Krieg und Zank zum Frieden zu führen. Sie versuchen es auch und gerade da, wo es vergeblich scheint. Wo sie fehlen, wird es brandgefährlich.
Botschafter und Botschafterinnen der Versöhnung können wir Kirchen nur sein, wenn wir unter uns selbst immer und immer wieder Versöhnung stiften. Das heißt: reden, reden und nochmal reden. Das haben wir in Karlsruhe erlebt - auch und gerade bei den sensiblen und schwierigen Themen. Mein Vorgänger im Amt des Ratsvorsitzes, Landesbischof Bedford-Strohm, wurde von der Vollversammlung zum neuen Moderator gewählt. Ich meine, diese Aufgabe ist ihm wirklich auf den Leib geschneidert.
In Deutschland hat das Verhältnis zur katholischen Kirche traditionell ein besonderes Gewicht. Auch hier bleiben wir im Gespräch. Deshalb haben wir den Kontaktgesprächskreis, deshalb gibt es so viel regelmäßigen Austausch und gemeinsame Termine.
Mein Antrittsbesuch bei Bischof Bätzing, dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, war für den 25. Februar terminiert, also am Tag nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Ein unerwarteter und schrecklicher ökumenischer Kairos. Uns beiden war klar: Jetzt sind wir Kirchen mit einer gemeinsamen Stimme gefragt. Und wir haben sie gemeinsam erhoben.
In unserem bemerkenswert offenen Gespräch wurde einerseits deutlich, wie stabil das Verhältnis zwischen den beiden großen Kirchen ist. Wir wollen und werden uns nicht mehr grundsätzlich auseinanderdividieren lassen und können einander auch unsere Befürchtungen und Nöte ehrlich eingestehen. Der Vertrauensverlust beider Kirchen, auch das wurde mir klar, führt die römisch-katholische Kirche in eine viel existenziellere innere Zerreißprobe als die evangelische Kirche. Davon bleibt auch unser ökumenisches Miteinander nicht unberührt.
Ich bewundere als evangelische Christin den Mut, mit der in der katholischen Kirche substanzielle Kernfragen des eigenen Selbstverständnisses diskutiert werden. Da geht es radikal an die Wurzeln. Das Bestreben, sich zu öffnen und gleichzeitig katholisch zu bleiben, führt unsere Schwesterkirche in vielfältige Spannungen. Welches Frustrationspotential und welche Risiken dies birgt, konnte man bei der letzten Versammlung des Synodalen Weges eindrücklich beobachten.
Im Sommer waren wir mit einer kleinen Delegation zu einem Austausch mit Kardinal Koch in Rom. Diese Begegnung war ebenso offen und ehrlich wie ernüchternd - etwa im Blick auf die kritischen Positionen Roms zum Synodalen Weg in Deutschland und zum Votum des Ökumenischen Arbeitskreises „Gemeinsam am Tisch des Herrn“.
Es müssen nicht alle Konflikte gelöst und nicht alle Fragen beantwortet sein, um gemeinsam zu handeln. Manchmal hilft es ungemein, wenn wir uns zusammen für Dritte einsetzen, zum Beispiel Geflüchtete unterstützen oder gemeinsam den ökumenischen Pilgerweg für Klimagerechtigkeit beschreiten und dabei spürt: Es geht nicht um uns, sondern um Christus in dieser Welt. Niemand rede solche „Kooperationsökumene“ klein! Es geht, wie Kirchenpräsident Volker Jung in seinem Bericht über die Catholica-Arbeit in der EKD und der GEKE formuliert, um die „gemeinsame Suche nach einer glaubwürdigen Frömmigkeit im 21. Jahrhundert und nach neuen Formen von Kirche.“ Das ist ein mühsamer Weg in manche Tiefe, aber ein Weg mit Verheißung.
-
VII. „Herr, geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.“
Was für eine Reaktion auf den grandiosen Fang! Kein „Wow!“, keine ausgelassene Freude. Kein „Bleib bei uns, so etwas wollen wir jeden Tag haben!“ Stattdessen Schrecken: „Geh weg von mir! Ich bin ein sündiger Mensch.“
Was hat Simon Schlimmes getan? Hat er etwa nicht genug mitgeholfen, als sie den Fang an Land geschleppt haben? Wir sind hier beim Kern dessen, was Sünde ist: ein von den Mächten des Todes beherrschtes Dasein, in dem wir gefangen sind. Sünde, das ist ein Netz von Verhängnis und Schuld, in dem der Mensch zappelt und aus dem er sich nicht durch eigene Grandiosität oder Selbstwirksamkeit befreien kann. So einer bin ich, erkennt Simon.
Wie mächtig, wie dramatisch und schier unauflösbar solche Sündenverstrickung ist, zeigt sich erschütternd konkret und schonungslos in der sexualisierten Gewalt, deren sich unsere Kirche schuldig gemacht hat und immer noch macht. Die Sünde ist mehr als die Addition der einzelnen Taten – obwohl allein deren Summe unerträglich ist. Die Sünde betrifft nicht allein einzelne Täter und Täterinnen, wir alle sind darein verstrickt, niemand kann sagen: Mit mir hat das nichts zu tun. Befreiung fängt mit dem Erschrecken darüber an: Ich bin ein sündiger Mensch. Nur wer sich der eigenen Schuld stellt, wird frei umzukehren. Das ist unendlich mühsam. Und es ist nicht so, dass wir irgendwann sagen könnten: Jetzt sind wir fertig damit.
Aus dieser Haltung heraus können und werden wir aktiv Sorge dafür tragen, immer neue Verbrechen an menschlicher Würde zu verhindern. Die Synode hat sich dazu verpflichtet, genau und verbindlich hinzuschauen, wo es um die Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung geht. Der Rat hat dieses leidvolle und schuldbeladene Thema ganz vorne auf die Agenda seiner Leitungsverantwortung gestellt.
Erschütternde Nachrichten reißen nicht ab: Es sind die Berichte von Menschen, die am eigenen Leib sexualisierte Gewalt im Raum der Kirche erlitten haben. Mehr und mehr bringen sie ans Licht, in welchem Ausmaß sexualisierte Gewalt durch Mitarbeitende der evangelischen Kirche und Diakonie in der Vergangenheit ausgeübt wurde und immer noch wird. Ich erschrecke darüber, wie viel Mut es nach wie vor braucht, grenzverletzendes Verhalten anzuzeigen und sexualisierte Gewalt als solche zu benennen.
Wir sind noch längst nicht an dem selbstgesteckten Ziel angekommen, wo Schutzkonzepte allerorten selbstverständliche Grundlage sind und wo Intervention und Aufarbeitung eingeübten Verfahren nach professionellen Standards folgen, die betroffene Personen beteiligen und auf die sich alle Beteiligten verlassen können.
Die Gewaltschutzrichtlinie wird in den einzelnen Landeskirchen zunehmend konsequent umgesetzt: Institutionelle Schutzkonzepte beginnen zu greifen, Mitarbeitende nehmen ihre Meldepflicht wahr, Präventionsarbeit aus einer klaren Haltung heraus verändert nach und nach zu einer geschulten Wahrnehmung und Sicherheit im achtsamen Umgang miteinander. Hier hat sich viel getan!
Und doch erleben Betroffene mancherorts eine im buchstäblichen Sinne frag-würdige Aufarbeitung dessen, was sie erleiden mussten: Menschen in leitender Verantwortung sind unsicher und bringen den Mut zu konsequentem Handeln nicht auf. Betroffene erfahren, dass ihnen nicht geglaubt wird und sie sich rechtfertigen sollen. In Disziplinarverfahren erleben sie sich ungenügend informiert, und wenn wir uns in der Kirche mit dem Thema beschäftigen, sehen sie sich immer noch nicht ausreichend ernstgenommen und nicht genügend beteiligt als Fachleute für ihre eigene Geschichte.
Dies alles ist mir deutlich geworden in persönlichen Gesprächen mit Betroffenen. Sehr kostbar war für mich der vertrauensvolle Austausch mit den Mitgliedern der „Interessengemeinschaft“, die sich inzwischen im neu geschaffenen Beteiligungsforum engagieren. Ich war berührt und auch beschämt von der Offenheit, die mir dort entgegenkam. Selbstverständlich fand ich das nicht. Wir werden unseren Austausch fortsetzen, das haben wir gemeinsam bekräftigt. Es darf uns einfach nicht in Ruhe lassen. Ich danke allen, die uns nicht in Ruhe lassen, weil es ihnen keine Ruhe lässt: zuallererst den Betroffenen. Ich danke allen Beauftragten und den Vielen, die in den Landeskirchen und in der Diakonie in diesem Thema engagiert sind. Das neue Format des Beteiligungsforums stellt sicher, dass betroffene Menschen maßgeblich einbezogen werden in sämtliche synodalen Entscheidungen, die das Thema sexualisierte Gewalt betreffen. Ich halte das für einen wichtigen und zukunftsweisenden Schritt.
-
VIII. „Sie verließen alles und folgten ihm nach.“
Und was wird nun aus den ganzen schönen Fischen? In der Vernunft purer Finanzsystematik wäre der vernünftige Weg: Erstmal die Schäflein, pardon: Fischlein ins Trockene bringen. Einen Teil auf dem Markt verkaufen, einen Teil einsalzen. Und einige jetzt schon braten, am besten verbunden mit einem innovativen Format. Ich mache mich hier keineswegs lustig über unsere finanzielle Vernunft. Ich will uns lediglich vor Augen halten, wie verrückt das Ende der biblischen Geschichte ist – und wie es die Maßstäbe verrückt. Nachdem die Jünger auf Jesu Wort hin in die Tiefe aufgebrochen sind, gehen sie in die Weite, ganz ohne Aufforderung, ganz ohne Befehl. Sie, die ein furchtbarer Schrecken erfasst hatte, werden nun getrieben von einer schrecklichen Begeisterung, in der keiner sie aufhalten kann, nicht einmal sie selbst. Sie machen auf radikale und unheimliche Weise Ernst mit dem Appell, den wir über unsere 12 Leitsätze geschrieben haben:
Hinaus ins Weite!
Drei Worte nur – und sie gehen dabei wirklich weit: „Sie verließen alles.“ Keine Angst, Hohe Synode. Das Finale dieses Berichts wird nicht in urchristlichem Furor bestehen und in dem Ruf, es ihnen nachzutun. Dafür stehen unsere 12 Leitsätze dezidiert nicht. Wir wollen und sollen nicht alles verlassen. Wir wollen Jesus nachfolgen, indem wir, wie es im Vorwort der Leitsätze heißt: „aufbrechen zu Neuem, Bewährtes stärken und Abschied von Vertrautem nehmen“.
„Sie verließen alles“: Diese drei Worte sind wie die Sprungfeder in einem Sessel. Sie bewahrt uns davor, dass wir´s uns allzu gemütlich darin machen. Wir müssen einiges lassen und verlassen, wenn wir Jesus in die Zukunft folgen wollen. Der Rat hat große Lust dazu.
Wie sehr es mich selber reizt, das habe ich an jenem Abend gespürt, von dem ich eingangs erzählte. Die muslimische Juristin hat mich gefragt, ob ihre Gemeinde nicht mitmachen könne bei unserer Aktion #wärmewinter. Und da war mir, als hätte ich auf einer Sprungfeder gesessen. Und ich habe gesagt: „Na klar!“