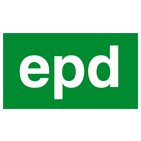„Nach dem 8. Mai 45 galt: Augen zu und durch“
Kirchenhistoriker Thomas Kück zur Verdrängung der NS-Zeit auch in der Kirche

Das Ende des Zweiten Weltkriegs zwang auch die evangelischen Kirchen zum Umdenken. Wie langsam sich dieses vollzog, zeigt der Blick auf den damaligen hannoverschen Landesbischof August Marahrens (1875-1950), der wegen seiner Kompromisse mit dem NS-Staat schon damals hochumstritten war. Warum die Kirchenbasis und die Landessynode nach dem Krieg noch lange an ihm festhielten, erläutert der Theologieprofessor Thomas Kück von der Universität Lüneburg.
Herr Professor Kück, wie müssen wir uns das kirchliche Leben in den Wochen nach dem 8. Mai 1945 vorstellen?
Thomas Kück: Ungefähr ein Drittel der deutschen evangelischen Pfarrer war eingezogen, verwundet, gefallen oder in Gefangenschaft. In der hannoverschen Landeskirche betraf dies außerdem 90 Prozent aller Pfarramtskandidaten und Vikare. Ältere Pastoren oder Pensionäre mussten daher Vertretungen übernehmen, Pfarrfrauen hielten Andachten. In den größeren Städten waren die Kirchen zerstört oder beschädigt, oftmals waren die Glocken eingezogen worden.
In Niedersachsen kamen Millionen Flüchtlinge an. Dies führte zu Chaos auf den Straßen und in den Gemeinden. Im Verhältnis aller Bundesländer hat Niederachsen am zweitmeisten Flüchtlinge aus den Ostgebieten aufgenommen, darunter auch viele Katholiken. Protestanten und Katholiken nutzten Gottesdiensträume vielerorts gemeinsam. Diese Zeit war deshalb die Geburtsstunde der Ökumene.
Insgesamt war der Neuanfang 1945 geprägt von alltäglicher Not und Verdrängung. Die Menschen vor und nach dem 8. Mai trennte kein tiefer Graben, sondern eher ein diffuses Feld von „Augen zu und durch“.
Wie ging Bischof August Marahrens mit der neuen Situation um?
Kück: Marahrens ordnete sein Verhalten einer von ihm empfundenen doppelten Verantwortung unter: der Verkündigung des Evangeliums und der Gemeinschaft mit seinem Volk. Zudem war er alternativlos überzeugt, dass Christen der Obrigkeit Gehorsam leisten müssen. Noch im August 1943 hatte Marahrens daher den von Goebbels ausgerufenen „Totalen Krieg“ befürwortet, den Krieg als „aufgezwungenen Lebenskampf“ gedeutet und im November 1944 die Einberufung des Volkssturms unterstützt. Nach den Grenzen des Gehorsams hat Marahrens nicht gefragt.
„Er wollte einen Schlusstrich ziehen!“
Unmittelbar nach dem Kriegsende wandelten sich seine Worte. Das zeigen seine Wochenbriefe, die in der Landeskirche verschickt wurden. Darin deutet er Anfang Juni das Kirchenvolk als verführte Herde, die von bösen Raubtieren überfallen wurde, womit offenbar die Nazis gemeint sind. Durchaus selbstkritisch räumt Marahrens ein, dass es Versagen „in unseren eigenen Reihen“ gab, aber jetzt gelte die Zusage, dass Gott es selbst richten werde. Die Funktion dieses Textes ist offenbar Entlastung.
In einem weiteren Wochenbrief fragt Marahrens auch nach seiner eigenen Schuld. Vor allem mit Blick auf die Verbrechen an den Juden erklärt er, „dass Schuld auf unserem Wege liegt“. Auch hier geht es um Selbstrechtfertigung und Verdrängung. Marahrens war noch nicht bereit, die NS-Herrscher offen anzuklagen und zu verurteilen. Stattdessen wollte er − im Sommer 1945! − einen Schlussstrich ziehen. „Damit möchte ich das Kapitel der umstrittenen Vergangenheit schließen“, schrieb er. So hat Marahrens dazu beigetragen, dass eine kollektive Verdrängung stattfand und dass die NS-Herrschaft als etwas Fremdes gedeutet wurde, an dem die Bevölkerung irgendwie kaum Anteil hatte.
Wie ist Marahrens mit der Kritik an seiner Amtsführung umgegangen?
Kück: Er hat sie bis zu seinem Tod nie wirklich verstanden. Dazu muss man wissen, dass er als Person eher behäbig und langsam war. Die Situation nach Kriegsende hat ihn offenbar überfordert. Bei der Gründung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) im hessischen Treysa im August 1945 war er zwar anwesend, wurde aber von vielen geschnitten und nicht mehr beteiligt. Namhafte Theologen wie Karl Barth und Martin Niemöller sparten nicht mit schwerer Kritik an ihm. Seine bischöflichen Kollegen distanzierten sich. Das hat ihn tief getroffen und seine letzten Jahre im Kloster Loccum belastet, eben weil er es nicht einsehen wollte.
„Organisation des Alltags schien wichtiger als Aufarbeitung“
Die Kritiker waren allerdings in der Minderheit. Für die Mehrheit der Pfarrerschaft und der kirchlichen Bevölkerung wurde Marahrens zu einem Symbol eines angemessenen Umgangs mit Verantwortung im und nach dem NS-Staat. Bei seinem Rücktritt 1947 stärkte ihm die Landessynode deutlich den Rücken. Der Vorsitzende der „Bekenntnisgemeinschaft“ in der Synode, Johannes Schulze, würdigte Marahrens mit den Worten: „Er ist ein Bischof gewesen.“
Wie ging die Landeskirche mit dezidierten Nazis in den eigenen Reihen um?
Kück: Das stand damals eher nicht im Vordergrund. Die Organisation des schwierigen Alltags schien wichtiger als die Aufarbeitung der eigenen und fremden Verstrickung in das NS-Regime. Öffentlich sichtbar wurde die zumindest nach außen erklärte Abwendung von der NS-Vergangenheit durch die Wiederaufnahme von Menschen, die wegen ihrer NS-Überzeugung aus der Kirche ausgetreten waren. Wie sollten Gemeinden damit umgehen? Vor einer Wiederaufnahme mussten die Betroffenen regelmäßig am Sonntagsgottesdienst teilnehmen und für alle sichtbar auf gesonderten Plätzen sitzen sowie in Einzelfällen vor einem Abendmahlsgottesdienst ein Gebet zur eigenen Buße sprechen.
„Die Motive von handelnden Personen bleiben ähnlich“
Kirchengeschichtlich erinnert dieses Verfahren an die Wiederaufnahme von sogenannten „Abgefallenen“, den Lapsi, die angesichts der Christenverfolgungen im Römischen Reich ihren Glauben verleugnet hatten und anschließend wieder zur Gemeinde gehören wollten. Heute wissen wir, dass die individuellen Verstrickungen in den NS-Staat wesentlich zahlreicher waren, als es die Frage nach „dezidierten“ Nazis nahelegen könnte.
Können wir etwas aus der Zeit vor 80 Jahren lernen?
Kück: Ob aus der Geschichte gelernt werden kann, ist mir eher zweifelhaft. Geschichte wiederholt sich nicht, und insofern können auch Lehrsätze der Geschichte nicht wiederholt angewandt werden. Aber die Motive von handelnden Menschen bleiben ähnlich. Warum handeln Menschen unter bestimmten historischen Bedingungen, wie sie handeln? Hier ließe sich mit Kenntnissen aus der Geschichte ansetzen: Warum passen sich Menschen an? Warum leisten sie Widerstand? Hier sehe ich eine Bildungsaufgabe: Menschen Mut zu machen und zu stärken - damit sie erkennen, wann der Gehorsam zu verweigern ist, und selbst in existenzieller Bedrohung für ihre Mitmenschen einstehen.
Interview: Urs Mundt (epd)