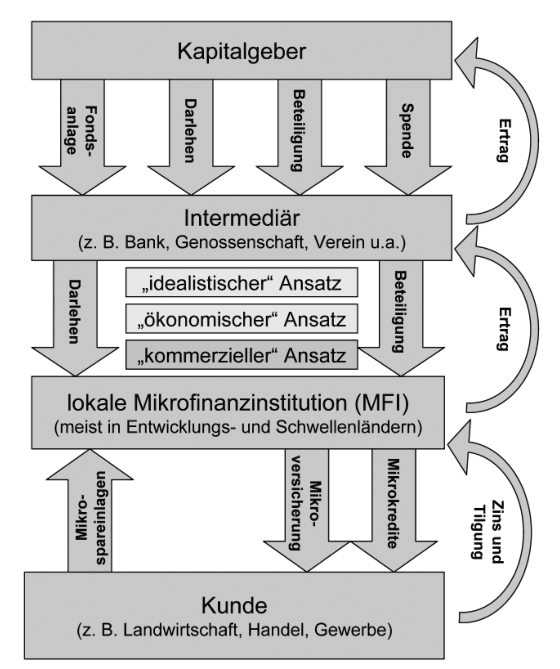III. Beschreibung der Instrumente
III.3. Themen- und Direktinvestments
Direktinvestments sind unmittelbare Beteiligungen an Unternehmen [4] oder Anlagen in Sachwerte (Immobilien, Infrastruktur, Rohstoffe, Agrarinvestitionen). In diesem Sinne sind Direktinvestments die Anlageform, mit der ein Geldanleger am ehesten seine individuellen Vorstellungen von Ethik und Nachhaltigkeit umsetzen kann. Diese Anlagen verlangen gleichzeitig jedoch auch einen hohen Arbeits- und Controllingaufwand sowie eine intensive Beschäftigung mit den zugrunde liegenden Produkten.
Themeninvestments sind Geldanlagen, die auf bestimmte Themen fokussiert sind.
Mikrofinanzanlagen sind eine besondere Form der Bereitstellung von Geld zur Unterstützung von Menschen in Entwicklungs- und Schwellenländern.
Hedgefonds-Anlagen sind keine Themeninvestments in obigem Sinne, benötigen jedoch durch ihre vielfältigen Strategiemöglichkeiten ein besonderes Augenmerk.
3.1 Unternehmensbeteiligungen
Üblicherweise erfolgen direkte Beteiligungen an Unternehmen durch den Kauf von Aktien oder Gesellschaftsanteilen sowie durch sog. "stille Einlagen". Insbesondere für sehr langfristige und erfahrene Geldanleger besteht auch die Möglichkeit, Geld als Beteiligungskapital zur Finanzierung neu gegründeter oder schnell wachsender Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Diese Unternehmen sind in der Regel (noch) nicht börsennotiert ("Private Equity").
Private-Equity-Beteiligungen haben üblicherweise einen sehr langfristigen Anlagehorizont und sind durch ein hohes Maß an zwischenzeitlicher Unveräußerbarkeit ("Infungibilität") gekennzeichnet. Bei Zeichnung von Beteiligungsanteilen fließt nicht sofort die gesamte zugesagte Investitionssumme; vielmehr wird diese erst sukzessive bei jeweils neu abgeschlossenen Beteiligungsverträgen eingefordert. Durch die längerfristige Investitionsphase dieser Beteiligungen fließen in den ersten Jahren dem Geldanleger keine oder nur geringe Ausschüttungen zu. Der Wert der Geldanlage kann insbesondere in der Investitionsphase phasenweise unter den Einstandswert sinken.
Eine ethisch nachhaltige Ausrichtung von Private-Equity-Beteiligungen ist noch selten und setzt eine intensive Beschäftigung mit den eingegangenen Beteiligungen voraus - ggf. unter Einschaltung weiterer Expertise. Die Aussagen über Ausschluss- und Positivkriterien gelten entsprechend.
3.2 Immobilien
Immobilienanlagen können sowohl direkt (Projektentwicklungen, Käufe) als auch indirekt (Fondsanlagen) getätigt werden. Die Einbeziehung ethisch nachhaltiger Aspekte in den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie ist möglich; dies gilt sowohl für Neubauten als auch für Instandhaltungsmaßnahmen bei Bestandsimmobilien.
Beispiele für die Berücksichtigung ethisch nachhaltiger Aspekte in den unterschiedlichen Phasen eines Immobilienzyklus:
Planungsphase
- Ausrichtung der Gebäude (Sonnenseite mit Fenster, Nordseite ohne)
- Harmonisches Nebeneinander von Gewerbe- und Wohnimmobilien (Lärmbelästigung, Soziokultur)
- Förderung von Familie und Beruf durch schnell erreichbare Kinderbetreuungsmöglichkeiten
- Anbindung an ÖPNV
- Einsatz regional verfügbarer Rohstoffe
- Barrierefreiheit
- Umweltmanagement (z. B. recyclingfähige Baustoffe bzw. Baustoffabfälle)
- Arbeitsplatzqualität (Schall-, Licht-, Klimaqualität, Deckenhöhe, Kommunikationsräume)
Beauftragung von ausführenden Unternehmen
- Relation Leiharbeiter zu Festangestellten
- Tarifgebundene Entlohnung
- Verhinderung von Schwarzarbeit und Korruption
- Förderung von kleinen und mittelgroßen regionalen oder lokalen Unternehmen
Bauphase
- Verhinderung von überflüssigen Belastungen für die Umwelt
- Reduzierung des Baulärms
- Einsatz moderner energieeffizienter und umweltfreundlicher Maschinen und Fahrzeuge
- Trennung von Bauabfällen und Nutzung von Rücknahmesystemen/Recycling
- Baubetreuung auch für Anwohner
Betrieb des Gebäudes
- Schonung von Ressourcen (z. B. Müllvermeidung, Trinkwasserverbrauch)
- Energieeffizienzv
- Vermeidung von "Angst-Räumen" (z. B. unbeleuchtete Parkplätze und Wege)
- Einsatz von recyclingfähigen Betriebsmitteln
- Regelmäßige Sanierung und Instandhaltung
Nutzung
- Berücksichtigung von Ausschluss- und Positivkriterien bei der Auswahl von Mietern
- Schaffung von Kommunikationsräumen
- fairer Interessenausgleich zwischen Vermieter und Mieter
Die Nachhaltigkeit von Immobilien wird inzwischen vielfach mit einem Zertifikat dokumentiert. Beispiele für solche Zertifikate sind BREEAM, LEED, Dt. Gütesiegel Nachhaltiges Bauen - DGNB. Bislang ist jedoch die Bewertungssystematik der Zertifizierungen uneinheitlich und wenig vergleichbar.
Im evangelischen Bereich gibt es für Immobilien bereits verschiedene Umweltmanagementsysteme - z. B. "Der Grüne Gockel" oder "Der Grüne Hahn".
3.3 Infrastruktur
Mit "Infrastruktur" werden die wirtschaftlichen und organisatorischen Grundlagen bezeichnet, die für das Funktionieren und die Entwicklung einer Volkswirtschaft nötig sind. Infrastrukturprojekte stellen die Versorgung der Allgemeinheit mit grundlegenden Dienstleistungen sicher und ermöglichen den Transport von Gütern und Informationen zum Verbraucher.
Geldanleger mit langfristigem Anlagehorizont können sich auch an Infrastrukturprojekten wie beispielsweise Häfen, Mautstraßen und Flughäfen, aber auch Schulen, Krankenhäusern, Kommunikationssystemen und Stromversorgung beteiligen. Die Ausschüttungen setzen häufig erst nach Fertigstellung der Projekte ein - oft erst nach Jahren. Politische und wirtschaftliche Risiken sind nicht auszuschließen. So lassen beispielsweise neue Anforderungen an den Betrieb eines Projekts, die Sicherheit oder höhere Umweltstandards oftmals neue (Nach-) Investitionen notwendig werden. Ähnlich wie bei Private-Equity-Anlagen wird das investierte Geld auch hier über viele Jahre gebunden.
Eine Beteiligung an Infrastrukturprojekten, die aus ethisch nachhaltiger Sicht sinnvoll sein können, setzt ein hohes Maß an Sachwissen voraus. Die ethisch nachhaltige Beurteilung (z. B. ökologische Verträglichkeit, gesellschaftlicher Nutzen usw.) ist bei jedem Einzelprojekt neu zu treffen. Die Einschaltung weiterer Expertise ist anzuraten.
3.4 Rohstoffinvestments
Rohstoffe als Geldanlage sind aus ethisch nachhaltiger Sicht oft problematisch.
Rohstoffe sind natürliche Ressourcen, die entweder direkt konsumiert oder als Ausgangsmaterial für weitere Verarbeitungsstufen in der Produktion verwendet werden. Die Gewinnung von Rohstoffen ist immer mit einem Eingriff in die Natur verbunden. Außerdem kommen häufig chemische und physikalische Methoden zur Anwendung, die der Umwelt schaden. Auch die Arbeitsbedingungen in der Rohstoffgewinnung und deren sozialen Folgen stehen immer wieder in der Kritik.
Wird in Form von Aktien und Unternehmensanleihen investiert oder in Form von direkten Beteiligungen an der Rohstoffgewinnung, kommen die an anderen Stellen erläuterten Instrumente Ausschluss- und Positivkriterien sowie Engagement zum Einsatz. So sind aufgrund der für Unternehmen geltenden Kriterien die Produzenten von Tabak und für Atomwaffen geeigneten radioaktiven Stoffen ebenso ausgeschlossen wie Unternehmen, die gegen die ILO-Kernarbeitsnormen verstoßen oder Unternehmen, die durch korrupte Strukturen Monopole zu Lasten der ansässigen Bevölkerung aufrecht erhalten. Aktien und Unternehmensanleihen sowie Agrarinvestitionen sind darum nicht Gegenstand dieses Abschnitts.
Bei Rohstoffinvestments lassen sich nach der Art des Erwerbs drei Kategorien unterscheiden: Direkterwerb, über Terminmärkte und indirekter Erwerb über Fonds und Zertifikate. Allen gemeinsam ist, dass aus den Anlagen kaum inhärenter Ertrag entsteht; der angestrebte Mehrwert wird in der Regel aus der richtigen Einschätzung eines Preistrends erzielt. Direkter Erwerb von Rohstoffen: Da Lieferung und Lagerhaltung von Rohstoffen mit hohem Aufwand verbunden sind, betrifft der Kauf physischer Güter in erster Linie die Edelmetalle. Ein Motiv für eine Geldanlage in Edelmetalle ist der Schutz vor Geldentwertung.
Eine Berücksichtigung ethisch-nachhaltiger Aspekte ist schwierig, da Herkunftsnachweise bei Rohstoffen eher die Ausnahme als die Regel sind. Sofern vorhanden, kann nach den Verfahren des fairen Handels vorgegangen und z.B. „Fairtrade und Fairmined“ Gold erworben werden. Generell ist es erstrebenswert, dass auch die weiterverarbeitende Industrie beim Kauf von Rohstoffen auf Herkunftsnachweise und Arbeitsbedingungen bei den Lieferanten achtet.
Rohstofferwerb über Terminmärkte: Die entsprechenden Finanzinstrumente gehören zur Gruppe der Derivate, die sich auf einen Basiswert beziehen. Käufer und Verkäufer von Derivaten orientieren sich in ihren Entscheidungen an der vermuteten zukünftigen Entwicklung dieses Basiswerts, z.B. dem Kassapreis eines einzelnen Rohstoffs oder eines Rohstoffindexes.
Anhand ihrer Motive lassen sich zwei Hauptgruppen von Marktteilnehmern unterscheiden: Produzenten, Abnehmer und Händler auf der einen Seite und Finanzinvestoren auf der anderen Seite. Ersteren geht es um die Absicherung gegen unerwünschte Preisänderungen und das Erlangen größerer Planungssicherheit, die letzteren streben Gewinne durch die richtige Einschätzung von Preistrends an.
Die Terminmärkte sind Handelsplätze für Marktpreiserwartungen und nicht für Handelsvolumen, das in der Zukunft tatsächlich wirksam wird. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass Aktivitäten auf den Terminmärkten Auswirkungen auf die Rohstoffpreise haben, und zwar in der Form, dass sie vorhandene Trends verstärken und zu Preisübertreibungen nach oben und unten beitragen.
Aus ethisch nachhaltiger Sicht wäre es problematisch, wenn Finanzinvestoren Preisverzerrungen bei Nahrungsmitteln verursachen würden, die weltweit zu einer Verschärfung von Hungersnöten beitragen. Preisübertreibungen nach oben verteuern für Verbraucher den Kauf von Nahrungsmitteln; Preisübertreibungen nach unten lassen den Ertrag für kleinbäuerliche Erzeuger sinken. In der wissenschaftlichen Diskussion ist die Wirkung von Finanzspekulation mit Nahrungsmitteln umstritten. Solange der Verdacht einer negativen Wirkung nicht ausgeräumt werden kann, ist aus ethisch nachhaltiger Sicht die Geldanlage an den Nahrungsmittel-Terminmärkten auszuschließen.
Indirekter Erwerb über Rohstoff-Zertifikate und -Fonds: Sowohl bei den Rohstoff-Fonds als auch bei den Zertifikaten gibt es börsengehandelte Produkte, die als ETF (Exchange Traded Funds) bzw. ETC (Exchange Traded Commodities) bezeichnet werden. Sie haben als rein passive Investments zum Ziel, die Wertentwicklung eines Basiswertes möglichst exakt abzubilden. Bei den entsprechenden Basiswerten handelt es sich im Rohstoffbereich in der Regel um die Preise für Einzelrohstoffe und Indizes auf den Terminmärkten. Da die Terminmärkte nur darauf spezialisierten Anlegern offen stehen, wird mit dieser Produktgruppe allen Investoren ein indirekter Zugang geschaffen.
Handelt es sich beim Basiswert eines Rohstoff-Zertifikats oder -Fonds um einen Korb von verschiedenen Rohstoffen oder um einen Index, sollte vor der Investitionsentscheidung eine Analyse der enthaltenen Einzelwerte vorgenommen werden, um sicherzustellen, dass das Finanzprodukt den Zielen des Anlegers entspricht. Zudem ist auf ausreichende Transparenz der Investmentstrategien und Researchprozesse zu achten. Sollte die Analyse ergeben, dass die Einzelwerte Nahrungsmittel einschließen, so gelten die im Abschnitt „Rohstofferwerb über Terminmärkte“ vorgebrachten Bedenken zu Nahrungsmittelinvestments auch für diese Finanzprodukte: Solange eine Beeinflussung der Nahrungsmittelpreise durch den Handel mit den entsprechenden Rohstoff-Zertifikaten und -Fonds nicht ausgeschlossen werden kann, kommen sie aus ethisch nachhaltiger Sicht für eine Geldanlage nicht in Betracht.
3.5 Agrarinvestitionen
Unter Agrarinvestitionen werden Käufe von Ackerflächen oder Forstbeständen (sog. "timber") verstanden. Der Geldanleger profitiert bei dieser Investmentform von steigenden Landpreisen und von Einnahmen aus jährlicher Ernte oder der Bewirtschaftung (Holzverkauf). Entsprechend hoch sind auch die Risiken durch Preisverfall von Land oder Ernten sowie durch Ernteausfälle aufgrund von Wettereinflüssen (Sturm, Hagel, Trockenperioden) oder Schädlingsbefall.
Aus ethisch nachhaltiger Sicht ist eine solche Geldanlage problematisch, wenn dadurch Ausbeutung, Monokulturen, Raubbau oder Kahlschlag gefördert werden oder kurzfristige hohe Erträge durch den unverhältnismäßigen Einsatz von Düngemitteln generiert werden. Da viele dieser Investitionen in Schwellen- oder Entwicklungsländern erfolgen, besteht zugleich neben dem allgemeinen politischen Risiko die Gefahr der Bildung von großen monopolartigen Agrarbetrieben, die die Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen durch Familienbetriebe verhindern oder sogar dem Zugriff der lokalen Bevölkerung völlig entziehen ("land grabbing"). Großflächig eingesetzte Beregnungsanlagen können zudem zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung führen oder den Grundwasserspiegel sinken lassen. Problematisch sind Investments auch dann, wenn die Flächen zur Erzeugung von Pflanzen zur Energiegewinnung statt für Nahrungsmittel genutzt oder gar umgewidmet werden.
Andererseits kann eine Investition jedoch auch positiv dazu beitragen, die Rodung von Waldflächen zu stoppen und Waldbestand zu sichern oder eine für die Allgemeinheit nützliche und notwendige Infrastruktur zu schaffen (beispielsweise bessere Trinkwasserversorgung, Investition in Bewässerungssysteme oder Beteiligung von Kleinbauern an landwirtschaftlicher Technologie).
Die Haltedauer einer Agrarinvestition ist im Regelfall sehr lang. Gerade Waldflächen benötigen zwischen 10 und 30 Jahren Wachstum, bevor nennenswerte Erträge erwirtschaftet werden können.
Die Beurteilung ethisch nachhaltiger Aspekte von Agrarinvestitionen setzt ein hohes Maß an Sachwissen voraus. Die Einbeziehung weiterer Expertise ist anzuraten.
3.6 Themeninvestment
Mit einer thematischen Ausrichtung seiner Geldanlage setzt ein Anleger auf den Erfolg einer bestimmten, nach ethisch nachhaltigen Aspekten ausgewählten Branche oder Technologie.
Beispiele für solche Themenanlagen sind Beteiligungen an Unternehmen oder Projekten,
- die regenerative Energiegewinnung fördern oder entwickeln (Solar, Windkraft, Wasserkraft)
- die sich zukunftsgerichtet mit der Ressource Wasser auseinandersetzen (Ver-/Entsorgung, Wasseraufbereitung, Wasserverbrauch)
- die Techniken zur Reduzierung von Emissionen entwickeln und herstellen
- die sich den Prinzipien des fairen Handels verpflichtet haben
- der Kreislaufwirtschaft/des Recyclings
Durch die Beschränkung des zur Verfügung stehenden "Anlageuniversums" ist jedoch zu beachten, dass unter Umständen ein erhöhtes Risiko durch fehlende Diversifikationsmöglichkeiten bestehen kann. Die Aussagen über Ausschluss- und Positivkriterien gelten hier entsprechend.
3.7 Mikrofinanz
Mikrofinanz bezeichnet die Bereitstellung von finanziellen Basisdienstleistungen wie Kredite, Geldanlagen oder Versicherungen an Kunden in Entwicklungs- und Schwellenländern, die aus verschiedenen Gründen keinen Zugang zu herkömmlichen Banken haben.
Unter Mikrokredit versteht man die Kreditvergabe von sehr kleinen Krediten durch Mikrofinanzinstitutionen (MFI) an arme Bevölkerungsgruppen, die traditionell keine Sicherheiten stellen können oder deren Einkommen zu gering sind. Typischerweise wird damit den Kreditnehmern die Möglichkeit eröffnet, ihre individuelle Einkommenssituation zu verbessern, z. B. durch Gründung oder Erweiterung eines Kleinstgewerbes. Häufiger Kritikpunkt bei Mikrofinanzanlagen sind die oftmals sehr hohen Zinsen, die die Endabnehmer bezahlen müssen. Auch wenn die Zinsen niedriger sind als bei lokalen Geldhändlern, ist dieser Aspekt vor der Investition in Mikrofinanzprodukte zu prüfen.
Die Attraktivität von Mikrofinanzprodukten wurde in der Vergangenheit mit Rückzahlungsquoten der Mikrokredite begründet, die oftmals höher lagen als die Rückzahlungsquoten im konventionellen Kreditgeschäft hiesiger Banken. Da sich diese Konstellationen jederzeit ändern können, sollte dieser Aspekt nicht als alleiniges Argument für eine Entscheidung über eine Geldanlage in Mikrofinanz dienen.
MFI bieten für die lokale Bevölkerung ebenfalls oft die Möglichkeit, Vermögenswerte anzusparen. Diese Anlagen bringen Zinsen und können von der MFI als Kredite verliehen werden. Als Kunden für klassische Geschäftsbanken kommen die Sparer oftmals nicht in Frage, da sie über kein regelmäßiges Einkommen oder auch nicht über notwendige Ausweisdokumente verfügen. Ein Markt für Mikroversicherungen, etwa gegen Ernteausfälle oder Krankheit, ist erst im Entstehen.
Als Geldanleger investiert man in der Regel nicht direkt bei MFI, sondern bedient sich eines Intermediärs. Dies kann beispielsweise eine Bank, eine Genossenschaft oder eine Kapitalgesellschaft sein. Diese wiederum leiten die eingesetzten Mittel an vor Ort tätige MFI weiter, die die eigentlichen Mikrokredite vergeben.
Abb. 3: Schematische Darstellung der Mikrofinanzbeteiligten
Die Auswahl des Intermediärs - und damit indirekt auch der lokalen Mikrofinanzinstitution - hat mit großer Sorgfalt zu erfolgen, da damit über die Intention des Mikrokreditgeschäfts entschieden wird. So ist es für den Geldanleger wichtig zu wissen, ob der Intermediär und die MFI einen eher "idealistischen" Ansatz verfolgt, nach dem das Geld vom Geldanleger ohne oder nur für eine geringe Verzinsung zur Verfügung gestellt wird (Subvention der MFI und der Mikrokreditzinsen) oder ob das Ziel eines für alle Beteiligten "ökonomischen" Nutzens (marktgerechte Verzinsung des angelegten Geldes, kostendeckende Organisation der MFI, allerdings auch höhere Mikrokreditzinsen) verfolgt wird. Die Vergabe von "kommerziellen" Mikrokrediten zu Konsumzwecken ist abzulehnen, da dies oftmals den Beginn des Wegs in die Schuldenfalle bedeutet.
3.8 Hedgefonds
Ein Investment in Hedgefonds ist aus ethisch nachhaltiger Sicht oft problematisch.
Hedgefonds sind gemäß § 112 Investmentgesetz "Sondervermögen mit zusätzlichen Risiken". Sie versuchen mit flexiblen Anlagemethoden in verschiedenen Marktphasen Gewinne zu erzielen. Grundsätzlich haben Hedgefonds eine große Investitionsfreiheit. Aufgrund der Vielfältigkeit der im Markt befindlichen Hedgefondsstrategien, die von überaus konservativ bis zu hoch spekulativ reichen, ist eine verallgemeinernde Aussage über ein mögliches Investment nicht angebracht. Die Beurteilung einer möglichen Geldanlage, auch unter Berücksichtigung ethisch nachhaltiger Aspekte, in Hedgefonds setzt ein hohes Maß an Sachwissen voraus. Die Einbeziehung weiterer Expertise ist anzuraten.
Folgende Aspekte sind vor einer Anlageentscheidung zu prüfen:
- Transparenz des Investmentprozesses
- Nachvollziehbarkeit der Anlageentscheidungen
- Angemessenheit des Verhältnisses von Fremd- zu Eigenkapital
- Steuerliche Behandlung des Hedgefonds und dessen Domizilierung
- Berücksichtigung ethisch nachhaltiger Aspekte