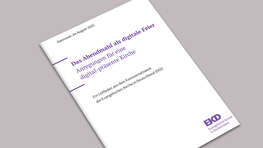Das Abendmahl als digitale Feier
Anregungen für eine digital-präsente Kirche
Ein Leitfaden aus dem Kammernetzwerk der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) August 2025.
Vorwort
Konkreter Anlass für diesen Leitfaden war eine 2021 vom Rat der EKD in Auftrag gegebene Befassung mit Fragen, die vor allem die stiftungs- und ordnungsgemäße Feier des Abendmahls, den Umgang mit digitaler Medialität, die Qualifizierung derer, die das Abendmahl liturgisch verantworten und die Konsequenzen für die weitere Sakraments- und Kasualpraxis einschließlich der möglichen Variationsbreite in der Gestaltung betreffen. Aus kirchenleitender Perspektive werden jetzt – nach Sichtung verschiedener Digitalformate, gliedkirchlicher Äußerungen zur Sache und einem im Kammernetzwerk der EKD veranstalteten und vom Rat der EKD beauftragten Symposium – gemeinsame Linien zum Ausdruck gebracht, die eine qualitativ angemessene und eindeutig identifizierbare Feier des Sakraments im Digitalen ermöglichen. Die Textform des Leitfadens wurde seitens der Theologischen Ausschüsse der Amtsbereiche der UEK und der VELKD kritisch begleitet.
Handlungsleitende Checkliste für digitale Abendmahlsformate
Digitale Abendmahlsformate – das heißt alle Formate, in denen digitalen Endgeräte zum Einsatz kommen – sind grundsätzlich möglich. Folgende Hinweise sind zu beachten.
-
Es bleibt im Blick, dass das Abendmahl nicht mit digitalen Tischgemeinschaften aller Art verwechselbar ist, sondern eine gottesdienstliche Feier meint.
Die Feier weist alle daran Beteiligten eindeutig wahrnehmbar darauf hin, dass wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus feiern, der uns an seinen Tisch eingeladen hat und mitten unter uns ist. -
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass mit der ebenfalls auf Christus selbst verweisenden Einsetzung des Abendmahls die Feier mit den in den Einsetzungsworten genannten Elementen Brot und Wein bzw. unvergorenem Traubensaft bei allen an der Feier Beteiligten gefeiert werden kann.
Die Elemente sind nicht beliebig austauschbar z. B. Chips, Tapas, Cola, Gummibärchen … -
Es ist im Blick, dass unabdingbar mit den Elementen Brot und Kelch die Heilsbedeutung verbunden ist, die in der Feier des Abendmahls liegt.
Die Bitte um Gottes Gegenwart bei der Feier und den dabei verwendeten Gaben (z. B. im sogenannten „Epiklese“-Gebet in der Abendmahlsliturgie) darf gerade auch im digitalen Vollzug des Abendmahls nicht vernachlässigt werden. Im Gebet wird die Anwesenheit des sichtbar Abwesenden ansprechbar und vorstellbar. -
Es ist sichergestellt, dass die Feier des Abendmahls auch in digitalen Formaten vom Vollzug des Gebens und empfangenden Nehmen lebt.
Es muss bei aller sorgfältigen Kreativität ein erfahrbares Vollziehen des Gebens und empfangenden Nehmen gewährleistet sein, das die Zusage und Verheißung Christi trägt, die mit dem Abendmahl gegeben ist und geglaubt wird. -
Es ist darauf zu achten, dass ein Feiern in digitalen Formaten nicht zu ungewollten Ausgrenzungen führen darf.
Gemeint ist hier z. B., wenn der digitale Zugang durch fehlende technische Ausstattung nicht möglich ist. Die Feier des Abendmahls im digitalen Format verweist deshalb auch immer auf die Zugänglichkeit physisch präsenter Feiern und ermöglicht diese auch.
Praxishilfen aus den Gottesdienstinstituten der Gliedkirchen finden sich unten im Anhang.
Einleitung
Das Abendmahl wird im Raum der evangelischen Kirche in Deutschland seit einigen Jahren auch in digitalen Formaten gefeiert. Dies ist nicht erst der seit den Pandemie-Jahren 2021/2022 (Covid-19/ Corona) der Fall, als physische Präsenzen im geschlossenen Räumen, darunter auch Kirchen und Gemeindehäuser, nahezu unmöglich waren. Mit einem fortschreitend digital unterstützten Leben in allen gesellschaftlichen Bereichen hat sich schon vor diesem pandemischen Einschnitt in und für manche kirchlichen Milieus eine digitale Kirchlichkeit entwickelt, die christlichen Glauben in Gemeinschaftsformen via digitaler Techniken lebbar und erlebbar machen möchte. Dies geschieht in wechselseitiger Durchdringung digitaler und analoger Sozialformen. Deshalb wird im Folgenden auch nicht von digitalem Abendmahl, sondern von der Feier des Abendmahls in digitalen Formaten gesprochen.
Allerdings gibt es in Teilen der Kirche – auch solchen, die gegenüber den Möglichkeiten digitaler Kommunikation aufgeschlossen sind – auch ein Unbehagen und Schwierigkeiten im Umgang mit einer digitalen Kirchlichkeit, die als defizitär wahrgenommen und als bestenfalls in Notsituationen zulässig betrachtet wird. Als das Original, die Norm und der Vollsinn von Kommunikation wird dort die physische Präsenz der Teilnehmenden betrachtet.
Angesichts dessen wird man konstatieren müssen, dass die Haltung der kirchlich Verbundenen gegenüber den Möglichkeiten einer digitalen kirchlichen Kommunikation nicht eindeutig ist. Die Kommunikationsformen in der Kirche befinden sich vielmehr im Übergang, wobei es keine klare Option für den Zielpunkt dieses Übergangs gibt: es kann sein, dass sich ein Bewusstsein für die Probleme der digitalen Kommunikation und eine Höherbewertung der physischen Präsenz etabliert bleibt, es kann auch sein, dass in einigen Jahren die Digitalisierung der Kommunikationsformen fraglos geworden ist. Insoweit ist der folgende Leitfaden vorläufig und auf Anpassungen an den Fortschritt der Diskussion angewiesen.
Abendmahl ist wesentlich ein im Rahmen eines öffentlichen Gottesdienstes inszeniertes Kommunikationsgeschehen im Glauben. Es ist Sakrament, d.h. sicht- und erfahrbare Gestalt des Evangeliums. Das ist und bleibt es auch im Digitalen und in digitalen Formaten.
Evangelische Kirchenleitung ist sich der Verantwortung für eine (er-)lebbare Glaubenskommunikation im Digitalen bewusst. Denn: Was traditionell im Analogen eingeübt ist, mag manchen im Digitalen irritieren. Deshalb will der hier von der EKD unter Beteiligung von Mitgliedern des Kammernetzwerkes und externen Expert*innen erarbeitete Leitfaden die Denkprozesse in Landeskirchen und Kirchengemeinden unterstützen, die Kirche im Digitalen biblisch fundiert und bekenntniskonform auch über die pandemische Notsituation hinaus gestalten wollen. Dabei sei auch an die Eigenverantwortung der in der Kirche Handelnden erinnert. Eine Checkliste, gleich zu Beginn des Textes, fasst zusammen, was für digitale Formate zu bedenken ist, damit das Sakrament als solches erkennbar bleibt.
Bekenntnis- und verständnisorientiert basiert der hier vorgelegte Leitfaden zum „Abendmahl in digitalen Formaten“ auf den „vordigitalen“ konsensualen Bemühungen der Leuenberger Konkordie von 1973. Diese wird zunächst aufgerufen (Teil 1), um die Bedarfe unter den veränderten Voraussetzungen der Digitalität zu verdeutlichen. Die gemeinsamen Linien orientieren in grundsätzlichen Fragen der liturgischen Abendmahlsfeier (Teil 2) und bieten in drei Abschnitten theologische Klärungen im Blick auf die praktischen Vollzüge im Digitalen: A. Präsenz und Leiblichkeit im Digitalen; B. Digitalisiertes Vollzugsgeschehen im Geben und empfangenden Nehmen; C. Digital-Präsente Gemeinschaftsformen. Es soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass und wie eine stiftungsgemäße Feier des Abendmahls in einer gegenwärtig fluiden Lebenswelt auch in digitalen Formaten gewährleistet werden kann.
Wenn der Leitfaden dazu dienen kann, weitere gliedkirchliche Beschlussfassungen zur Ermöglichung von Abendmahlsfeiern in digitalen Formaten anzuregen, hat er seinen Beitrag zur Sache erfüllt.
Zum Schluss (Teil 3) werden Stichpunkte benannt, die einem Weiterdenken an den Herausforderungen für die Zukunft einer digitalen Kirche dienen können.
Teil 1: Die Leuenberger Konkordie in einer sich digital verändernden Kirche
Die Leuenberger Konkordie von 1973 ist Zeugnis dafür, wie kulturelle, allgemein-gesellschaftliche und christlich-religiöse Transformationen zu neuen Denk- und Ausdrucksformen des Kirche-Seins führen können. Scheinbar unüberwindbare Ressentiments konnten in Rückbesinnung auf die biblischen Grundaussagen und auf die Geschichtlichkeit jeder Realisationsform der Kirche aufgebrochen werden, um zwischen lutherischen und reformierten und aus ihnen hervorgegangenen unierten Kirchen eine Kirchengemeinschaft erklären zu können und verwirklichen zu lassen. Zum Konsens im Verständnis der Feier des Abendmahls wird festgehalten:
Im Abendmahl schenkt sich der auferstandene Jesus Christus in seinem für alle dahingegebenen Leib und Blut durch sein verheißendes Wort mit Brot und Wein. Er gewährt uns dadurch Vergebung der Sünden und befreit uns zu einem neuen Leben aus Glauben. Er lässt uns neu erfahren, dass wir Glieder an seinem Leibe sind. Er stärkt uns zum Dienst an den Menschen.
Wenn wir das Abendmahl feiern, verkündigen wir den Tod Christi durch den Gott die Welt mit sich selbst versöhnt hat. Wir bekennen die Gegenwart des auferstandenen Herrn unter uns. In der Freude darüber, dass der Herr zu uns gekommen ist, warten wir auf seine Zukunft in Herrlichkeit.
Die derzeit in den verfassten evangelischen Kirchen in Deutschland in unterschiedlicher Gewichtung in Geltung stehenden Liturgien bieten einen Rahmen, der die Grundaussagen des Abendmahls in deren Verbindlichkeit sichert. Variationen der Gestaltung – auch die digitale – sind an diese Verbindlichkeit gewiesen und müssen sich daran bewähren.
Zeitbedingt und dem kulturellen Wandel geschuldet wurden und werden neue Denkformen und Gestaltungsformate ausprobiert und etabliert, die als solche – wie die Leuenberger Konkordie betont – vom grundlegenden Zeugnis der reformatorischen Bekenntnisse zu unterscheiden sind und dieses in Geltung belassen.
Dennoch stellen sich bei jeder neuen Gestaltungsaufgabe – und dazu sind digitale Formate zu rechnen – alte Fragen noch einmal neu. Sie betreffen Präsenz und Vollzug, wenn diese nicht mehr nur in einem gemauerten Kirchenraum zu denken sind, sondern ortsübergreifend und virtuell. Sie betreffen Körperlichkeit/Leiblichkeit und die anwesend/abwesende Gemeinschaft aller Beteiligten am und im Mahlgeschehen, wenn dies jenseits geschichtlich geprägter Kulturen, Kohlenstofflichkeit und/oder bisher geltender Raum- und Zeitvorstellungen grenzüberschreitend ermöglicht werden kann.
Unter digitalen Formaten versteht der Leitfaden vor allem solche, in denen:
- alle an der Mahlfeier Beteiligten – einschließlich der zum liturgischen Dienst beauftragten Person – durch bild- und tongebende Technik zugleich versammelt sind. Von der Möglichkeit des Nachfeierns per Aufzeichnung ist abzusehen. Die Feier des Abendmahls ist auch in der Bildschirmübertragung ein unmittelbares Erlebnis, das – ähnlich wie beim Anschauen von aufgezeichneten Sport- und Konzertveranstaltungen – auf seinen Unterhaltungs- und Analysewert reduziert zu werden droht.
- in einem Kirchenraum mit und ohne Gemeindebeteiligung, aber in Anwesenheit einer zum liturgischen Dienst beauftragten Person, die eine Feier des Abendmahls leitet und bei der eine hybride Teilnahme per Übertragungstechnik ermöglicht ist.
Auch im digitalen Zeitalter ist es möglich, aus der Haltung, die in der Leuenberger Konkordie abgebildet ist, zu neuen Formaten auf der Grundlage des bleibend Gültigen zu finden. Ausgehend von der im Verständnis des Evangeliums gewonnenen Übereinstimmung in der Sache wird dort zur kontinuierlichen Weiterarbeit unter je und je sich verändernden Voraussetzungen aufgerufen. Zu nichts anderem will der Leitfaden für das Vollzugsgeschehen des Abendmahls in digitalen Formaten ermutigen. Im sichtbaren und erkennbaren Festhalten an dem, für den christlichen Glauben biblisch-theologisch begründeten und kirchlich-verfassten Grundgeschehen sind variabel-digitale Formen möglich, in denen das Grundgeschehen im Feiern des Abendmahls prinzipiell gegenwartstauglich, wie es der bleibend gültigen biblischen Handlungsanweisung – solches tut zu meinem Gedächtnis – entspricht.
Teil 2: Klärungen zur Feier des Abendmahls im digitalen Raum
Digitale Formate rufen ein neues Nachdenken über Anwesenheiten auf, das bisher Vertrautes und in natürlicher Begegnung Erfahrenes weiten kann. Der mit der Leuenberger Konkordie zur Geltung gebrachte Deutehorizont der Einsetzungsworte, der sowohl lutherischer als auch reformierter Theologie ein in aller Verschiedenheit doch gemeinsames Verstehen der Christuspräsenz ermöglicht hat, bedarf der Erweiterung im Digitalen. Präsenz- und Repräsentationsvorstellungen, wie sie vor dem sich abzeichnenden digitalen Kulturwandel geprägt worden sind, unterliegen einer veränderten Wahrnehmung, wenn nicht mehr nur einer – Christus – in der leibhaften Abwesenheit dennoch als gegenwärtig gelten soll, sondern auch die, die in der bisherigen Form an den Tisch des Herrn eingeladen sind, nicht mehr in einem Kirchenraum, sondern ortsungebunden und durch einen Bildschirm verbunden im gemeinschaftlichen Vollzug des Abendmahl mit Christus und einander verbunden sind.
A. Präsenz und Leiblichkeit im Digitalen
Die alte und grundsätzlich immer wieder neu zu stellende Frage nach der Gegenwart Christi im Mahlgeschehen ist erneut zu bedenken:
Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach’s und gab’s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr’s trinket zu meinem Gedächtnis.
Zunächst ist festzuhalten: Diese für den liturgischen Vollzug festgeschriebenen Worte (entspr. 1 Kor 11,23–25) behalten auch für jede Form der Mahlfeier im Digitalen ihre Geltung und Gültigkeit. Das digitale Abendmahl muss so gestaltet sein, dass diese Worte im Vollzug des Feierns sinnvoll bleiben.
In kirchlichen Formaten im Digitalen geschieht hier nicht mehr, aber auch nicht weniger als in gottesdienstlichen Feiern vor Ort. Präsenz und Leiblichkeit Christi entsprechen dem im Evangelium Bezeugten. Die Bibel kennt solche abwesend-anwesenden Glaubensvollzüge, nicht nur im Abendmahl: Seit der Himmelfahrt Christi (Mk 16,19f; Apg 1,9ff) leben die sich formierenden christlichen Gemeinden mit der augenscheinlichen körperlichen Abwesenheit ihres Herrn. Die Feier des Abendmahls ist die einzigartige Möglichkeit, sich der Präsenz Christi zu vergewissern. Er selbst hat Brot und Kelch zu Medien seiner Gegenwart im Bezug auf die Nacht des „Verrats“ (Mk 14,26) und auf den daraus folgenden Kreuzestod (1 Kor 11,26) gemacht.
Grundsätzlich lebt die Feier des Abendmahls von körperlicher Absenz und inszeniert-erinnerter Vergegenwärtigung. Sie ist geprägt vom Gedenken an das Leben Jesu, der Verkündigung seines Todes am Kreuz und in der Teilhabe am Leib des Auferstandenen. Geistgewirkt vergegenwärtigt sich Christus im Vollzug an das wort-gebundene Einsetzungshandeln in den Elementen Brot und Kelch. Wort und Element müssen zusammenkommen. In der auf Christus bezogenen Medialität bleibt das Abendmahl auch digital vollzogen Sakrament.
B. Digitalisiertes Vollzugsgeschehen im Geben und empfangenden Nehmen
Entscheidend für den Vollzug des Sakraments ist nicht nur die bloße Nennung der Elemente als Medien im liturgischen Handeln. Brot und Kelch werden vielmehr von Christus selbst in einer manifesten Handlung gegeben. Das bleibt im Verständnis des Glaubens auch so bis zur Wiederkunft Christi. Dass so und in der äußeren Form nicht anders gefeiert werden soll, zielt nicht auf die Betonung vergangener Tradition. Der Bezug auf ein in der Vergangenheit liegendes Ereignis mit seiner Markierung eines Erinnerungszeichens setzt ein zeitübergreifendes Gedächtnis auf Zukunft frei. Das Sakrament hat immer auch diesen eschatologischen, über die gegenwartsbezogene Zeiterfahrung hinausgehenden Gehalt. Die Elemente des Abendmahls schenkt sich Christus in, mit und unter den Elementen den Glaubenden selbst. Christus ist Gebender und Gabe zugleich. Deshalb ist das Geben, das immer ein empfangendes Gegenüber einschließt, und das Empfangen im Glauben, ein unteilbares Vollzugsgeschehen. Dem räumlichen Denken geschuldet ist dieser ungeteilte Vollzug schwer vorstellbar, wenn Geben und Empfangen durch ein digitales Format gleichsam unterbrochen wird. Wesentlich am Vollzug ist allerdings weniger die Frage eines einheitlichen dreidimensionalen Raumes als die Wahrung des Zusammenhangs von Gabe und Empfang, d.h. dem einsetzungsgemäßen Gebrauch von Brot und Wein. Im Empfangen haben Christ*innen Anteil an der Christuswirklichkeit. Das setzt nicht die Anwesenheit aller Beteiligten im selben Raum und zur selben Zeit voraus. Das gilt schon darum, weil auch traditionell der Gottesdienst der Kirche und das Abendmahl nicht begrenzt ist auf die leiblich vorhandene Gemeinde, sondern ein Vollzug der ganzen, raum- und zeitübergreifenden Kirche einschließlich der „Engelscharen“ (vgl. Präfation) ist. Sakramental ist der eine Raum mittels der Bitte um den Heiligen Geist geöffnet. Liturgisch geschieht dies in der Epiklese, d.h. der Bitte um die Gewissheit der Gegenwart Christi. Sie stellt in Brot und Kelch das geistgewirkte Bindeglied zwischen allen dar, denen das Abendmahl heilig ist und die so im Vollzugsgeschehen des Gebens und Nehmens geistlich verbunden sind. In den Vollzug des Abendmahls sind immer Personen über den Kreis der leiblich Anwesenden hinaus einbezogen. Brot und Kelch geben Anteil an der Heilsbedeutung des Lebens, Sterbens und Auferstehens Jesu Christi. Raum und Zeit übergreifend – und damit auch digitale Vorstellungswelten übergreifend – ist das Abendmahl Wegzehrung („bis er kommt“) in der Vollendung der Zeit und der Fülle der Gnade.
Es kommt nicht darauf an, dass das Brot oder der Kelch den Teilnehmenden am Mahl in die Hand gegeben wird. Das Abendmahl kommt genauso gültig zustande, wenn Teilnehmende das zuvor bereitgestellte Brot und den Kelch von einem Tisch nehmen und dabei die Spendeworte hören. Genauso ist das im Raum vor dem Bildschirm bereitgestellte Brot und der Kelch Medium der Gabe des Leibes und der Vergebung Christi, wenn beides auf die vom die Feier des Abendmahl Leitenden gesprochenen Spendeworte hin genommen wird. Dieser Zuspruch, der sich auf die Einsetzungsworte bezieht, konstituiert den Empfang Christi und seines Heils.
C. Digital-Präsente Gemeinschaftsformen in der Feier des Abendmahls
Gemeinschaft ist auch im Abendmahl geistige, soziale und körperliche Gemeinschaft. Allerdings ist die Gemeinschaft der Gläubigen nicht um ihrer selbst willen Gemeinschaft. Christ*innen feiern im gemeinschaftlichen Zusammenkommen untereinander die sicht- und erfahrbare geistliche Gemeinschaft mit Christus, in der Vergebung der Sünden geschieht und dies heilsam zum Leben wirksam ist. In der Feier des Abendmahls hat die konkrete Gemeinschaft derer, die zum Herrn gehören, identitätsstiftende Qualität. Christliche Gemeinschaft versteht sich darüber hinaus nicht nur als aktuell präsente, leib-körperliche Gemeinschaftsform, sondern steht in Verbindung mit all jenen, die in der Vergangenheit zur Gemeinschaft der Glaubenden gehörten und die noch zukünftig hinzukommen. Diese Vorstellung kann auch auf gegenwärtig-digitale Gemeinschaftsformen bezogen werden, insofern sich dort Menschen an verschiedenen Orten, aber mittels digitaler Kommunikationsmedien konkret-anwesend als Gemeinschaft der Gläubigen zusammenfinden. Die Feier des einsetzungsgemäß vollzogenen Abendmahls betreffend gilt auch hier: Das Abendmahl ist von Christus selbst eingesetzt, gestiftet und bestätigt. Christus allein ist als Wort Gottes das Haupt der Gemeinde. Seine Worte sind wahr und bürgen für seine Verheißung. In diesem auf Wiederholung und Wiedererkennbarkeit drängenden Kommunikationsgeschehen liegt der gemeinschaftsbildende und -erhaltende Aspekt des Abendmahls auch in digitalen Formaten.
In 1Kor 11,20 hebt Paulus für das Sättigungsmahl hervor: Menschliche Gemeinschaft untereinander läuft Gefahr, sozial und damit auch im Glauben auseinanderzubrechen. Es werden Unterschiede gemacht, die unter Menschen zu Ausgrenzungen führen – ein Verhalten, das Paulus in seiner gemeindeleitenden Verantwortung vom Grundsinn des Abendmahls her ablehnt. Nicht nur in der Frage des gemeinsamen Essens muss es darum gehen, alles zu tun, die christus-orientierte Gemeinschaft zusammenzuhalten und zu entwickeln, d.h. der Auferbauung der Gemeinde zu nützen. Dies gilt erst recht dort, wo man sich der Gemeinschaft mit Christus auch im digitalen Vollzugsgeschehen der Feier des Abendmahls bewusstwerden will.
Teil 3: Herausforderungen für Zukunft einer digitalen Kirche
Wie die Leuenberger Konkordie auch lässt die Verständigung über das Abendmahl im Raum des Digitalen nicht nur hier, sondern für weitere kirchliche Handlungsbereiche Fragen offen, die theologisch wie kirchenleitend, aber auch für jede einzelne Kirchengemeinde zum weiteren Durchdenken aufgeben sind. Auf drei Herausforderungen sei hier kurz hingewiesen, die weiter in ökumenischer Verbundenheit bearbeitet werden und weiter zu bearbeiten sind.
Taufe
Die Taufe muss auch im digitalen Raum als sakramentale Handlung erkennbar sein. Dazu gehört auch, dass eine Selbsttaufe auch vor dem Bildschirm nicht möglich ist. Weil die Taufe – u.a. kirchenrechtliche – Konsequenzen für die Glaubensgemeinschaft hat, ist sie – anders als das Abendmahl – ein auf die Einzelperson bezogener Akt, der durch eine andere Person vermittelt wird. Eine Wasserhandlung auf dem Bildschirm kann nicht übermittelt werden, es braucht (mindestens) zwei Personen. Ermutigt wird deshalb zu digital vermittelten Beteiligungsformaten, die zum Taufbegehren führen können: Siehe, da ist Wasser. Was hindert’s, dass ich mich taufen lasse? (Apg 8,38).
Der eigentliche Taufakt muss dann aufgeschoben werden, bis eine dazu beauftragte Person hinzutreten kann, um die Taufe mit Wasser und mit Bezug auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes zu vollziehen.
Kasualien in digitalen Formaten
Geistliche Gemeinschaft als Ausdruck des Miteinanders von Gott und Mensch braucht individuelle Lebensbegleitung. Lebensgeschichtliche und situative („neue“) Kasualien finden mehr und mehr auch digital transformiert statt. Das Vernetzungspotential des Digitalen ist dem Begegnen im traditionell Analogen deutlich überlegen. Dabei ist digital wie analog der Eventcharakter sorgsam abzuwägen und mit dem Bekenntnis- und Traditionsbestand zu vermitteln, der geprägte und unverlierbare Ausdrucksformen des Glaubens im Gedächtnis hält. Nicht zu unterschätzen ist in Zeiten selbstverständlich gewordener Mobilität die Möglichkeit, vor allem bei den lebensgeschichtlichen Begleitungen familial Angehörige und Freunde digital zuschalten zu können. Wahrnehmbar ist allerdings, dass gerade das situative Kasualhandeln, auch wenn es SocialMedia-Formate integriert, auf physische Begegnung und Vergemeinschaftung setzt.
Nicht zu unterschätzen ist in der eingangs angesprochenen Übergangssituation aber auch die immer noch bestehende kulturelle Orientierung an den Kommunikationsformen in physischer Präsenz gegenüber einer digitalen Präsenz, die vielfach als defizitär wahrgenommen wird. Es mag sein, dass sich das in den kommenden Jahren und Jahrzehnten ändert – in der Gegenwart ist das ein verbreitetes Unbehagen, das in Rechnung gestellt werden muss und im digitalen Überschwang nicht vergessen werden darf. Kirchliche Handlungen leben von Akzeptanz.
Ökumene
Es gilt, auch hinsichtlich digitaler Kirchlichkeit, ökumenisch mit allen (frei-)kirchlichen Gemeinschaften im Gespräch zu bleiben. Dies betrifft insbesondere die Dimension des Sakraments. Das mit der römischkatholischen Kirche hinsichtlich der Taufe schon Erreichte (Magdeburger Erklärung) sollte grundsätzlich nicht infrage gestellt werden. Das gilt auch für die Gespräche, die im Zusammenhang des Abendmahls geführt werden und sich allerdings nicht allein auf das Vollzugsgeschehen beziehen (Votum: Gemeinsam am Tisch des Herrn). Die Geschwisterkirchen in der Ökumene leben aber auch mit den Herausforderungen der Zeiten und Kulturen und suchen in ihnen nach Gestaltungsmöglichkeiten kirchlichen Lebens. Digitaltechniken bieten hier ein hohes Vernetzungspotential.
Aus-, Fort- Und Weiterbildung
Das Implementieren von kultureller Digitalkompetenzen der Aus-, Fort- und Weiterbildung der liturgisch beauftragten Personen ist – universitär und kirchlich – weiter auszubauen. Insbesondere auf die gesteigerte Bedeutung von Gesten und deren Ausdrucksformen wird beim gottesdienstlichen Handeln im Digitalen wert zu legen sein. Leitend ist die Befähigung zu einer digitalen pastoralen Identität, zu einem digital-affinen Diakonat und einem digital-kompetenten Ehrenamt. Damit zusammen hängen weitere Überlegungen zu Berufungen und Ordinationen zu kirchlichen Digital-Ämtern, die auch den sorgfältigen Umgang mit KI/AI/AR gewährleisten können.
Nachwort
Der Leitfaden ist sich der Begrenztheit seiner theologischen, konfessionellen und kirchenorganisatorischen Aussagekraft bewusst. Das betrifft:
Bekenntnis-Orientiertes und Theologisches: Wer in Sachen des christlichen Glaubens Grundlegendes aspekthaft bearbeitet, muss sich dessen bewusst bleiben, dass sich daraus weitere Fragestellungen ergeben. So bleiben die an der Frage des Digitalen mitzubedenkenden grundsätzlichen Deutungen des Abendmahls im Rahmen der auf die Verheißung Christi gründenden Heilszusage, die im Bekenntnis des christlichen Glaubens festgestellten Aussagen und das im theologischen Diskurs beständig aufgerufene Verstehen dieses Heilsgeschehens – auch angesichts schwindender Beteiligung an gottesdienstlichen Abendmahlsfeiern – eine dauernde Aufgabe.
Kirchenrechtliche und liturgische Klärungen: Diese müssen in den Amtsbereichen (VELKD und UEK) und in den Gliedkirchen eigenständig vorangebracht werden. Hierzu will der Leitfaden allerdings konstruktiv anregen.
Die Reichweite: Der Leitfaden versteht sich als Klärungshilfe im Raum der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), die mit ihren Gliedkirchen und ihren Gemeinden digitale Angebote weiter ausbauen wollen. Dennoch soll daran erinnert werden, das bei an das Digitalgeschehen angepasste Formulierungen kultursensibel und grenzachtend vorgenommen werden. Wegweisend haben sich einzelne Gliedkirchen bereits zur Sache verhalten. Digitale christliche Gemeinschaftsformen, die sich als digitale Kirche jenseits institutioneller und konfessionell-gebundener Kirchlichkeit bewegen, sind zwar im Blick, bedürfen aber einer eigenen Beschäftigung mit dem Verständnis von Kirche überhaupt. Auch da will der Leitfaden unterstützen.
Anhang
Praxishilfen für Abendmahlsfeiern in digitalen Formaten
- Fachstelle Gottesdienst der ELKWUE: Gottesdienstordnung zu Formen digital gefeierten Abendmahls in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg
- Zentrum Verkündigung Frankfurt: Orientierungshilfe, Abendmahl im digitalen Raum