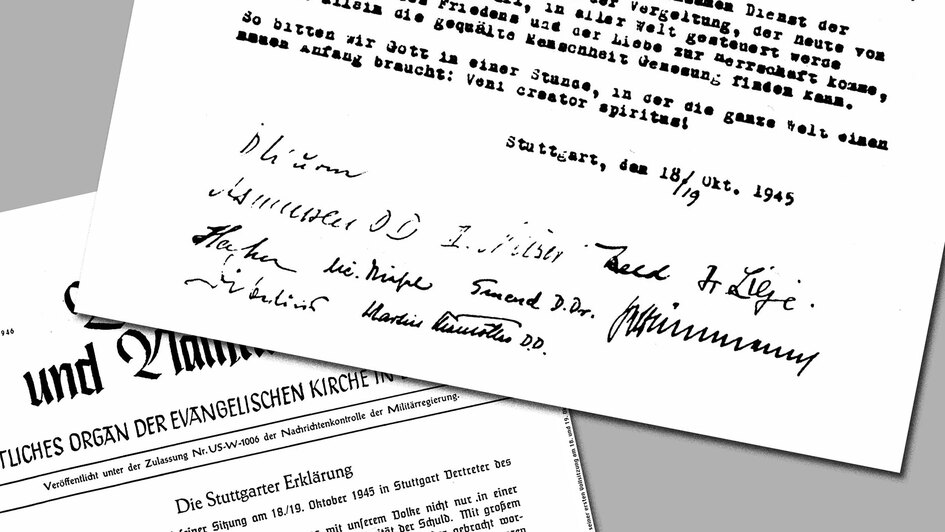Wehrdienst, Freiwilligkeit und Dienstpflicht
Historische Entwicklung und aktuelle Herausforderungen
Die evangelische Kirche begleitete in den 1950er Jahren die Gründung der Bundeswehr und die Einführung der Wehrpflicht kritisch. Das biblische Motto „Schwerter zu Pflugscharen" wurde zum Symbol der Friedensbewegung der 1980er Jahre. Nach dem Ende des Kalten Krieges wandelte sich die Bundeswehr zur Freiwilligenarmee. Die Wehrpflicht wurde 2011 ausgesetzt. Die sicherheitspolitische Lage hat sich seitdem grundlegend verändert. Die EKD-Denkschrift „Welt in Unordnung" bezieht in dieser Debatte deutlich Position.
Das biblische Tötungsverbot
Die Denkschrift setzt sich intensiv mit der theologischen Spannung zwischen dem fünften Gebot („Du sollst nicht töten") und der möglichen Legitimität staatlicher Gewaltanwendung auseinander. Sie betont: Das Tötungsverbot bezieht sich primär auf rechtswidriges Töten. Die legale Anwendung von Gewalt – etwa zum Schutz vor Gewalt – kann ethisch vertretbar oder sogar geboten sein. Allerdings bleibt jede Tötungshandlung legitimationsbedürftig und führt vor Gott zu Schuld – auch dann, wenn eine solche Tötung rechtlich und ethisch zu vertreten ist. Diese Spannung ist in einer noch nicht erlösten Welt, die der Macht der Sünde ausgesetzt ist, auszuhalten.
Wehrpflicht oder umfassende Dienstpflicht?
Die Aufgabe des Staates, Menschen vor Gewalt zu schützen, erfordert, dass ihm dazu genügend Ressourcen zur Verfügung stehen, materiell wie personell. Sich an der Verteidigung des Gemeinwesens zu beteiligen, kann aus christlicher Sicht eine Form des gebotenen Einsatzes für den Nächsten sein. Allerdings sollte dies als eine Selbstverpflichtung wahrgenommen werden, sodass die Denkschrift grundsätzlich für den Vorrang freiwilliger Dienste plädiert. Sollte es notwendig sein, Bürger zu diesem Dienst zu verpflichten, müssen die Kriterien dafür offen dargelegt werden. Vor allem aber müssen Überlegungen zum Wehrdienst oder gar einer Wehrpflicht eingebettet sein in ein umfassendes Konzept der Sicherheits- und Friedenspolitik. Das moderne Sicherheitsverständnis geht über militärische Aspekte hinaus. Gesellschaftliche Widerstandskraft braucht vielfältige Ansätze: Katastrophenschutz, Schutz kritischer Infrastruktur und Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Falls ein Pflichtdienst notwendig würde, wäre eine umfassende Dienstpflicht, die auch Zivildienst, Freiwilligendienste und andere Formen sozialen Engagements einbezieht, sinnvoller als die reine Wehrpflicht, steht aber vor nur schwer zu überwindenden rechtlichen und politischen Hürden.
Evangelische Position und gesellschaftlicher Weg
Aus evangelischer Sicht sollte der Ausbau freiwilliger Dienste Vorrang haben. Das gilt gleichermaßen für die Bundeswehr und zivile Bereiche. Die Gewissensentscheidung zur Kriegsdienstverweigerung bleibt unverzichtbares Grundrecht. Dies muss auch für Schutzsuchende aus anderen Ländern gelten. Jede Entscheidung zum Thema Wehrpflicht sollte auf eine breite gesellschaftliche Zustimmung bauen. Nur so werden moderne Verteidigung und freiheitliche Demokratie vereinbar.
Autor: ub