Verhältnis des deutschen Volkes zu seinen östlichen Nachbarn
„Ostdenkschrift“
Die sogenannte Ostdenkschrift der EKD von 1965 setzt sich mit der seit Ende des Zweiten Weltkriegs äußerst umstrittenen Frage der deutschen Ostgebiete sowie dem Verhältnis Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn Polen und der Sowjetunion auseinander.
Sie klagt das Unrecht an, das den deutschen Vertriebenen geschehen war. Gleichzeitig regt sie dazu an, die bisherige Anspruchshaltung vieler Deutscher in Bezug auf die ehemaligen deutschen Gebiete jenseits der Oder-Neiße-Linie zu hinterfragen. Damit brach sie ein politisches Tabu der Nachkriegszeit und lenkte den Blick weg von der Idee einer Wiederherstellung Deutschlands in den Grenzen von 1937. Die Ostdenkschrift gilt als eine der wichtigsten politisch-moralischen Stellungnahmen der Nachkriegszeit, die weit über den kirchlichen Horizont hinauswirkte.
Versöhnung und Neuanfang
Mit dem Fokus auf Versöhnung und dem Ziel einer gesamteuropäischen Friedensordnung stellt die Denkschrift die bisherige Haltung Deutschlands zu den Ostgebieten infrage und regt eine Neubewertung der Situation an. Sie fordert die Anerkennung des Leids aller Betroffenen, benennt Schuld und Unrecht, ruft zur Überwindung von Feindbildern auf und plädiert für Verständigung statt für die Durchsetzung einseitiger Interessen. Sie warnt vor Scheinlösungen und drängt auf eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, um einen Neuanfang zu ermöglichen.
Im Rückblick betrachtet leistete die Denkschrift langfristig einen bedeutenden Beitrag zur deutsch-polnischen Verständigung, gab Impulse für die Ostpolitik der späteren sozialliberalen Koalition unter Willy Brandt und trug zur Annäherung, Versöhnung und zum Frieden in Europa bei.
Für wen ist dieses Buch?
- (Kirchen-)Historiker*innen
- Theolog*innen
- Politolog*innen
- Bildungseinrichtungen
- Kultureinrichtungen
- politische Öffentlichkeit
ub
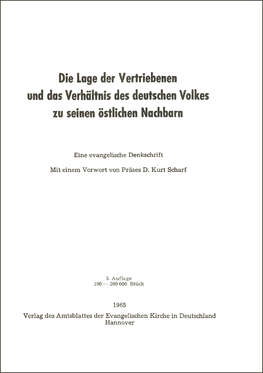
Die Ostdenkschrift der EKD aus dem Jahr 1965 setzt sich mit der damals strittigen Frage der deutschen Ostgebiete und dem Verhältnis Deutschlands zu seinen östlichen Nachbarn auseinander. Die Denkschrift ruft dazu auf, das Leid aller Betroffenen zu würdigen, Schuld und Unrecht klar zu benennen und Verständigung dem Beharren auf Eigeninteressen vorzuziehen. Sie betont, dass Versöhnung und Frieden nur auf der Basis von Wahrheit, Gerechtigkeit und dem Willen zum Neuanfang möglich sind. Heute gilt diese Schrift als einer der wichtigsten Impulse für die spätere Ostpolitik der Bundesrepublik.
Verlag des Amtsblattes der Evangelischen Kirche in Deutschland, 1965


