Synode 2025: EKD stellt neue Friedensdenkschrift vor
Evangelische Kirche aktualisiert christliche Friedensethik
Mit der neuen Friedensdenkschrift „Welt in Unordnung – Gerechter Friede im Blick“ reagiert die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) auf zunehmend komplexe Krisen- und Kriegssituationen weltweit. Auf der Synode in Dresden stellte der Rat der EKD seine weiterentwickelte Friedensethik vor – einen Aufruf zu Verantwortung, Schutz und Nächstenliebe in unsicheren Zeiten.
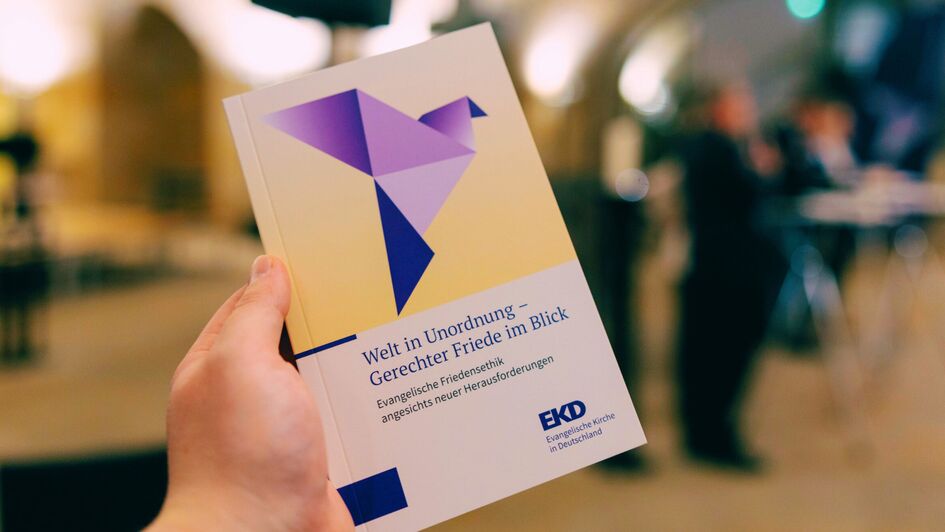
Wieso war es nötig, eine neue evangelische Friedensdenkschrift zu verfassen?
Die weltweite Sicherheitslage hat sich stark verändert. Kriege, Terror und neue Formen hybrider Bedrohung stellen die christliche Friedenethik vor neue Fragen. Die neue Friedensdenkschrift bietet dafür eine aktuelle ethische Orientierung.
Welche Perspektiven eröffnet die Denkschrift mit Blick auf aktuelle Bedrohungen?
Die Friedensethik betont den Schutz von Gewalt bedrohter Menschen als Ausdruck christlicher Nächstenliebe. Gewalt anzuwenden ist nicht möglich, ohne schuldig zu werden. Aber auch Menschen oder ein Staat machen sich schuldig, wenn sie Gewalt zulassen und Menschen nicht vor ihr schützen. Gewalt darf nur als letztes Mittel und unter ständiger ethischer Prüfung angewandt werden.
Wie definiert die neue Friedensdenkschrift das Leitbild eines Gerechten Friedens?
Der Gerechte Friede ist ein Prozess, in dem Gewalt ab- und Gerechtigkeit zunimmt. Frieden ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Er beruht auf Schutz vor Gewalt, Förderung von Freiheit, Abbau von Ungleichheiten sowie einem friedensfördernden Miteinander in Vielfalt.
Wie steht die Friedensdenkschrift zu den Themen Wehrdienst, Freiwilligkeit und Dienstpflicht?Die Friedensethik betont den Wert der Freiwilligkeit. Sicherheit ist mehr als militärische Sicherheit. Wenn eine Dienstpflicht nötig werden muss, sollte sie auch ziviles Engagement einschließen. Jede Entscheidung dazu braucht gesellschaftliche Zustimmung, um Demokratie und Sicherheit zu verbinden.
EKD-Ratsvorsitzende Fehrs: „Denkschrift als Kompass“
„Die Denkschrift ist ein Kompass durch eine Zeit voller Bedrohungen, Kriege und Konflikte. Mit der klaren Ausrichtung auf einen gerechten Frieden“, so die EKD-Ratsvorsitzende Bischöfin Kirsten Fehrs.
Der Denkschrift zufolge sind nachhaltiger Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit nur dann erreichbar, wenn körperliche Unversehrtheit und der Erhalt staatlicher Integrität gesichert sind. „Gerechter Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg. Es bleibt ein Gebot der Nächstenliebe, dass wir Menschen, die an Leib, Leben und ihrer Würde bedroht sind, nicht schutzlos der Gewalt ausgesetzt lassen“, so Bischöfin Fehrs. Letztlich bleibe ein Dilemma, dass sich nicht auflösen lasse. „Gewalt anzuwenden ist nicht möglich, ohne schuldig zu werden. Aber auch Menschen oder Staaten machen sich schuldig, die Gewalt zulassen und Menschen nicht vor ihr schützen.“
Die christliche Botschaft setze auf Hoffnung und Zuversicht statt auf Angstmacherei, so die EKD-Ratsvorsitzende weiter. „Kirchen sind Orte der Aufklärung, der Resilienz und des respektvollen Diskurses – gerade in Zeiten, in denen Manipulation und Falschinformation die öffentliche Debatte verzerren“, so Fehrs. Die neue Denkschrift stellt die Bedeutung der Bildungsarbeit für den Frieden heraus. Mit jährlich mehr als 90.000 Bildungsveranstaltungen mit über 1,6 Millionen Teilnehmenden gehört die evangelische Kirche zu den bundesweit größten Trägern von Bildungsarbeit. „Als Gesellschaft sollten wir die Wege zum Frieden kontrovers diskutieren, um nicht unkritisch in Spiralen der Kriegslogik zu geraten“, so Bischöfin Fehrs. „Deutschland muss friedenstüchtig bleiben, bei allen notwendigen Anstrengungen zur Verteidigungsfähigkeit.“

„Gerechter Frieden ist mehr als Abwesenheit von Krieg. Es bleibt ein Gebot der Nächstenliebe, dass wir Menschen, die an Leib, Leben und ihrer Würde bedroht sind, nicht schutzlos der Gewalt ausgesetzt lassen.“
Einblicke in die neue Friedensdenkschrift
Die Kernpunkte der neuen Friedensdenkschrift wurden den Synodalen von Prof. Dr. Reiner Anselm und Dr. Friederike Krippner, den Vorsitzenden des friedensethischen Redaktionsteams, vorgestellt.
„Ziel der neuen Friedensdenkschrift ist es, die Urteilsfähigkeit der Christinnen und Christen zu stärken“, sagte Krippner. „Sie will Gewissen bilden, nicht Gewissheiten liefern; sie will die Fähigkeiten stärken, in einer komplexen Welt verantwortlich zu urteilen und zu entscheiden.“ Anselm ergänzte, die Stärke der Schrift liege in ihrer Nüchternheit: „Wir wollten kein Manifest, sondern ein Werkzeug.“ Die Denkschrift solle nutzbar sein für Menschen und weder moralisch überfordern noch zu sehr vereinfachen. Die Denkschrift sei von einem eschatologischen Friedensbegriff geprägt: „Evangelische Friedensethik ist in der Gegenwart verwurzelt und zugleich hoffnungsvoll auf das Reich Gottes hin ausgerichtet.“
Er erläuterte, der Text stelle bewusst die Sündhaftigkeit des Menschen an den Anfang und spreche von deren Konsequenzen – als Ausdruck reformatorischer Ehrlichkeit. „Wer das Böse verdrängt, kann Gewalt nicht überwinden“, betonte er. Die Denkschrift vermittle daher eine Hoffnung, die die Realität der Welt aushalte, und ende im Vertrauen auf die Verheißung des Friedens Gottes.

„Die Friedensdenkschrift will Gewissen bilden, nicht Gewissheiten liefern; sie will die Fähigkeiten stärken, in einer komplexen Welt verantwortlich zu urteilen und zu entscheiden.“
Die Friedensdenkschrift über den Schutz vor Gewalt
Krippner erinnerte daran, dass bereits die Friedensdenkschrift von 2007 das ökumenische Leitbild des „Gerechten Friedens“ in vier Dimensionen entfaltet habe: Schutz vor Gewalt, Förderung von Freiheit, und, in der neuen Denkschrift leicht umformuliert: Abbau von Ungleichheiten und ein friedensfördernder Umgang mit Pluralität. Die neue Denkschrift betone nun besonders den Vorrang des Schutzes vor Gewalt: „Denn angesichts einer direkten Bedrohung von Leib und Leben sind Freiheit, Gleichheit und Pluralität nicht zu sichern.“
Anselm hob die besondere Verantwortung des Staates hervor, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen. „Nur wer sicher lebt, kann gerecht und frei leben“, sagte er. Aber zugleich bleibe Sicherheit ohne Vielfalt, Pluralität und Freiheit stets brüchig. Daran zeige sich auch die Nähe des gerechten Friedens zur Demokratie. Ein autokratischer Staat könne kein freies und pluralitätsfähiges Gemeinwesen schaffen, das dem Frieden diene.
Zur rechtserhaltenden Gewalt erklärte Krippner, sie sei stets ultima ratio und immer an das Recht gebunden. Militärische Gewalt könne nur als rechtserhaltende Gewalt legitim sein und müsse der Friedenslogik untergeordnet bleiben. Vorrang habe stets die zivile Konfliktbearbeitung.

Die Friedensdenkschrift über die Rolle der Kirche
Die Denkschrift argumentiere, dass es eine „ethische Verpflichtung aller zum Schutz des Gemeinwesens“ gebe, erläuterte Anselm. Ein verpflichtender Grundwehrdienst sei jedoch nur dann legitim, wenn der Schutz der Allgemeinheit anders nicht gewährleistet werden könne. Die Denkschrift rege eine Debatte um eine allgemeine Dienstpflicht an, die den vielfältigen Dimensionen von Sicherheiten und gaben der Menschen gerecht wird.
Krippner betonte zudem, dass sich die ökologische Dimension wie ein „rotes Band“ durch alle Kapitel ziehe. „Klimaschutz ist langfristige Konfliktprävention“, sagte sie. „Kein Weg geht an entschiedenem Klimaschutz vorbei.“ Zugleich wies sie darauf hin, dass langfristiger Klimaschutz kurzfristig zu Spannungen führen könne – diese Ambivalenz müsse ausgehalten und benannt werden.
Zur Rolle der Kirche erklärte Anselm, die Denkschrift erhebe den Anspruch, „dass der evangelische Glaube und die darauf bezogene Ethik andere orientieren“.
Zum Abschluss sagte Krippner: „Die Denkschrift hat einen klaren Blick auf die Unzulänglichkeiten unserer Welt. Und das ist vielleicht die größte Zumutung. Sie traut uns etwas zu: die Freiheit, im Vertrauen auf Gottes Frieden zu handeln.“
Synode diskutiert über Friedensdenkschrift
Die Aussprache im Plenum zeigte, dass die neue Friedensdenkschrift der EKD mit großem Interesse und Ernsthaftigkeit aufgenommen wurde. Sie gilt vielen als wichtiger und realistischer Beitrag zur friedensethischen Debatte, zugleich aber als herausforderndes Dokument, das weitere Diskussionen anstoßen soll. Deutlich wurde, dass sie unterschiedliche biografische und theologische Perspektiven – vom Pazifismus bis zur sicherheitspolitischen Verantwortung – aufnimmt und so als gemeinsamer Suchraum nach Orientierung in einer unfriedlichen Welt verstanden wird.
Viele Synodale betonten, dass die Denkschrift in einer Zeit globaler Krisen einen mutigen, realistischen und zugleich hoffnungsvollen Zugang zum Thema Frieden eröffnet. Sie sei kein Manifest, sondern ein Werkzeug, das Orientierung gebe und Raum für verantwortliche Urteilsbildung lasse. Besonders hervorgehoben wurden ihre theologische Tiefe, ihr Realismus in der Einschätzung politischer Konflikte und der Mut, Spannungen offenzuhalten, statt sie vorschnell aufzulösen. Als Stärke gilt zudem, dass sie spirituelle, ethische und gesellschaftliche Dimensionen des Friedens miteinander verbindet.
Kritischer Blick auf den Umgang mit Pazifismus
Die Synodale Linda Teuteberg begrüßte den realistischen Blick auf sicherheitspolitische Verantwortung und forderte mehr Selbstkritik bei der Einschätzung früherer kirchlicher und gesellschaftlicher Fehleinschätzungen. Die Politikerin und Synodale Katrin Göring-Eckardt reflektierte aus ihrer DDR-Biografie als Pazifistin über die Ambivalenz gewaltfreier Haltungen: Gewalt dürfe nie leichtfertig eingesetzt werden, doch die Kirche müsse diejenigen schützen, „die unter die Räuber gefallen sind“. Die Denkschrift sei ein Angebot zur verantwortlichen gesellschaftlichen Debatte.
Generalmajor Ruprecht von Butler begrüßte die Denkschrift als hilfreich für die Diskussion mit jungen Soldatinnen und Soldaten und als Orientierung in Gewissensfragen. „Ich wünsche mir, dass der Weg, den ich gewählt habe, um Frieden und Freiheit uns zu erhalten, durch die Kirche kritisch betrachtet wird, aber dass man es doch am Ende mittragen kann“, sagte er.
Vorstellung der Friedensdenkschrift auf der EKD-Synode
Die Vorsitzenden des friedensethischen Redaktionsteams, Prof. Dr. Reiner Anselm und Dr. Friederike Krippner, stellen auf der Synode in Dresden die neue Friedensdenkschrift des Rates der EKD vor. Anschließend diskutieren die Synodalen über das Papier und seine friedensethischen Impulse.
Ihre Cookie-Einstellungen verbieten das Laden dieses Videos



